Tacitus Publius Cornelius

Germania
Annalen I
Annalen II
Annalen XII
Annalen XIII
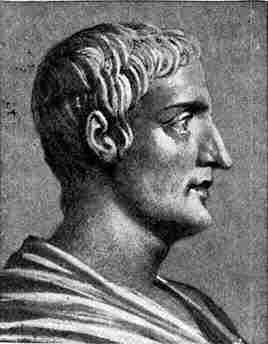
Germania
6. Auch an Eisen ist kein Überfluss, wie die Art der Bewaffnung zeigt. Nur wenige haben ein Schwert oder eine größere Lanze. Sie tragen Speere oder wie sie selbst sagen, Framen, mit schmaler und kurzer Eisenspitze, die jedoch so scharf und handlich ist, dass sie dieselbe Waffe je nach Bedarf für den Nah- oder Fernkampf verwenden können. Selbst der Reiter begnügt sich mit Schild und Frame; die Fußsoldaten werfen auch kleine Spieße, jeder mehrere, und sie schleudern sie ungeheuer weit: sie sind halb nackt oder tragen nur einen leichten Umhang. Prunken mit Waffenschmuck ist ihnen fremd; nur die Schilde bemalen sie mit auffallenden Farben. Wenige haben einen Panzer, kaum der eine oder andere einen Helm oder eine Lederkappe. Ihre Pferde zeichnet weder Schönheit noch Schnelligkeit aus. Sie werden auch nicht, wie bei uns, zu kunstvollen Wendungen abgerichtet; man reitet geradeaus oder mit einmaliger Schwenkung nach rechts, und zwar in so geschlossener Linie, dass niemand zurückbleibt. Aufs ganze gesehen liegt ihre Stärke mehr beim Fußvolk; daher kämpfen sie auch in gemischten Verbänden. Hierbei passt sich die Behändigkeit der Fußsoldaten genau dem Reiterkampfe an: man stellt nur Leute vor die Schlachtreihe, die aus der gesamten Jungmannschaft ausgewählt sind. Auch ist ihre Zahl begrenzt: aus jedem Gau sind es hundert, und eben hiernach werden sie bei ihnen genannt, und was ursprünglich nur eine Zahlbezeichnung war, gilt nunmehr auch als Ehrenname. Zum Kampfe stellt man sich in Keilen auf. Vom Platz zu weichen, wenn man nur wieder vordringt, hält man eher für wohlbedacht, nicht für feige. Ihre Toten bergen sie auch in unglücklicher Schlacht. Den Schild zu verlieren, ist eine Schmach ohnegleichen, und der so Entehrte darf weder an Opfern teilnehmen noch eine Versammlung besuchen und so mancher der heil aus dem Kriege zurückkehrte, hat seiner Schande mit dem Strick ein Ende gemacht.
7. Könige wählen sie nach Maßgabe des Adels, Heerführer nach der Tapferkeit. Selbst die Könige haben keine unbeschränkte oder freie Herrschergewalt, und die Heerführer erreichen mehr durch ihr Beispiel als durch Befehle: sie werden bewundert, wenn sie stets zur Stelle sind, wenn sie sich auszeichnen, wenn sie in vorderster Linie kämpfen. Übrigens ist es nur den Priestern erlaubt, jemanden hinzurichten, zu fesseln oder auch nur zu schlagen, und sie handeln nicht, um zu strafen oder auf Befehl des Heerführers, sondern gewissermaßen auf Geheiß der Gottheit, die, wie man glaubt, den Kämpfenden zur Seite steht. Deshalb nehmen die Germanen auch gewisse Bilder und Zeichen, die sie aus den heiligen Hainen holen, mit in die Schlacht. Besonders spornt sie zur Tapferkeit an, dass nicht Zufall und willkürliche Zusammenrottung, sondern Sippen und Geschlechter die Reiterhaufen oder die Schlachtkeile bilden.
Alles was man über Tacitus’ (um 55 n. Chr. bis ca. 115 n. Chr.) Leben weiß, stammt entweder aus seinen eigenen Werken oder aus Briefen des römischen Staatsmannes und Redners Plinius des Jüngeren, mit dem Tacitus eng befreundet war. In Rom geboren, bekleidete er im Jahre 79 n. Chr. vermutlich das Amt des Quästors, war 88 Prätor und 97 Konsul; um 112/113 war er vermutlich Prokonsul der Provinz Asia. Erst in den letzten Jahrzehnten seines Lebens konnte er sich seiner historisch-literarischen Arbeit, von der weniger als die Hälfte erhalten ist, widmen. Tacitus begann mit der Veröffentlichung seiner Werke erst nach der Gewaltherrschaft Domitians.
Das zweite der so genannten kleinen Werke des Tacitus trägt den Titel Germania (ca. 98 n. Chr.) und ist eine geographisch- völkerkundlerische Schrift über Germanien. Die Historien, das erste von Tacitus beiden Hauptwerken, wurde wahrscheinlich zwischen 104 und 109 n. Chr. veröffentlicht. Es beinhaltet die Geschichte des Römischen Reiches von 69 v. Chr. bis zur Ermordung des Kaisers Domitian im Jahre 96 n. Chr. Vom ursprünglichen Werk, dass wahrscheinlich aus 14 Büchern bestand, sind nur die ersten vier und Teile des fünften Teils erhalten. Die Annalen (ca. 115-117 n. Chr.) beschreiben die Geschichte der römischen Kaiser nach Augustus bis zum Tod Domitians, also den Zeitraum von 14 bis 68 n. Chr. Ursprünglich umfasste dieses Werk 16 Bücher, davon sind aber neben einigen Fragmenten, nur neun Bücher vollständig erhalten.
13. Niemals, weder bei Sachen der Gemeinde noch bei eigenen, erledigen sie etwas anderes als in Waffen. Doch darf keiner Waffen tragen, ehe ihn der Stamm für wehrfähig erklärt. Das geschieht in öffentlicher Versammlung: eines der Stammesoberhäupter oder der Vater oder Verwandte wappnen den jungen Mann mit Schild und Frame. Dies ist das Männerkleid der Germanen, dies die erste Zier der Jugend; vorher zählen sie nur zu Hause, von jetzt an zum Gemeinwesen. Hohe Abkunft oder große Verdienste der Väter verschaffen auch ganz jungen Leuten die Gunst eines Gefolgsherrn; sie werden den anderen zugestellt, die schon stärker und längst erprobt sind. Es ist auch keine Schande, unter den Gefolgsleuten zu erscheinen. Ja, innerhalb der Gefolgschaft gibt es sogar Rangstufen, nach der Bestimmung dessen, wem man sich anschließt. Und es herrscht lebhafter Wetteifer: der Gefolgsleute, wer die erste stelle beim Gefolgsherrn einnimmt, und der Gefolgsherrn, wer das größte Gefolge hat. So kommt man zu Ansehen, so zu Macht; Stets von einer großen Schar auserlesener junger Männer umgeben zu sein, ist im Frieden eine Zier, im Kriege ein Schutz. Und nicht nur im eigenen Stamme, auch bei den Nachbarn ist bekannt und berühmt, wer sich durch ein zahlreiches und tapferes Gefolge hervortut. Denn ihn umwirbt man durch Gesandte und ehrt man durch Geschenke, und schon sein Ruf verhindert oft einen drohenden Krieg.
Ovid
Horaz
Manilius
Strabo
Velleius Paterculus
Frontinius
Suetonius
Florus
Ptolemaios
Cassius Dio
14. Kommt es zur Schlacht, ist es schimpflich für den Gefolgsherrn, an Tapferkeit zurückzustehen, schimpflich für das Gefolge, es dem Herrn nicht gleichzutun. Doch für das ganze Leben lädt Schmach und Schande auf sich, wer seinen Herrn überlebend aus der Schlacht zurückkehrt: in zu schirmen und zu schützen, auch die eigenen Heldentaten ihm zum Ruhme anzurechnen, ist des Dienstes heiligste Pflicht. Die Herren kämpfen für den Sieg, die Gefolgsleute für den Herrn. Wenn der Heimatstamm in langer Friedensruhe erstarrt, suchen viele der jungen Adligen auf eigene Faust Völkerschaften auf, die gerade einen Krieg führen; denn Ruhe behagt diesem Volke nicht, und inmitten von Gefahren wird man leichter berühmt. Auch lässt sich ein großes Gefolge nur durch Gewalttat und Krieg unterhalten. Die Gefolgsleute erwarten nämlich von der Huld ihres Herrn ihr Streitross, ihre blutige und Siegbringende Frame. Denn die Mahlzeiten und die wenn auch einfachen, so doch reichlichen Schmausereien gelten als Sold. Die Mittel zu diesem Aufwand bieten Kriege und Raub. Und nicht so leicht könnte man einen Germanen dazu bringen, das Feld zu bestellen und die Ernte abzuwarten, als den Feind herauszufordern und sich Wunden zu holen; es gilt sogar für träge und schlaff, sich mit Schweiß zu erarbeiten, was man mit Blut erringen kann.
Lokalisierung der Varusschlacht durch Tacitus
Zurück zur Hauptseite
16. Dass die Völkerschaften der Germanen keine Städte bewohnen, ist hinreichend bekannt, ja dass sie nicht einmal zusammenhängende Siedlungen dulden. Sie hausen einzeln und gesondert, gerade wie ein Quell, eine Fläche, ein Gehölz ihnen zusagt. Ihre Dörfer legen sie nicht in unsere Weise an, dass die Gebäude verbunden sind und aneinander stoßen: jeder umgibt sein Haus mit freiem Raum, sei es zum Schutz gegen Feuersgefahr, sei es aus Unkenntnis im Bauen. Nicht einmal Bruchsteine oder Ziegel sind bei ihnen im Gebrauch; zu allem verwenden sie unbehauenes Holz, ohne auf ein gefälliges oder freundliches Aussehen zu achten. Einige Flächen bestreichen sie recht sorgfältig mit einer so blendendweißen Erde, dass es wie Bemalung und farbiges Linienwerk aussieht. Sie schachten auch oft im Erdboden Gruben aus und bedecken sie mit reichlich Dung, als Zuflucht für den Winter und als Fruchtspeicher. Derartige Räume schwächen nämlich die Wirkung der strengen Kälte, und wenn einmal der Feind kommt, dann verwüstet er nur, was offen daliegt; und doch das Verborgene und Vergrabene bemerkt er nicht, oder es entgeht ihm deshalb, weil er erst danach suchen müsste.
28. Auch die Ubier schämen sich ihres Ursprungs nicht, obwohl ihnen ihre Verdienste die Stellung einer römischen Kolonie eingebracht haben und sie sich lieber nach der Gründerin ihrer Stadt als Agrippinenser bezeichnen. Sie haben vor Zeiten den Rhein überschritten und wurden, da ihre Treue sich bewährte, unmittelbar am Ufer angesiedelt, als Wächter, nicht als Bewachte.
29. Von allen diesen Stämmen sind die Bataver am tapfersten. Sie bewohnen einen Streifen am linken Ufer und in der Hauptsache die Rheininsel. Ursprünglich ein Zweig der Chatten, zogen sie wegen inneren Zwistes in die jetzigen Wohnsitze, wo sie dem römischen Reich einverleibt werden sollten. Die Ehre und Auszeichnung alter Bundesgenossenschaft hat bis heute bestand; denn kein Zins demütigt sie, und kein Steuerpächter presst sie aus. Frei von Lasten und Abgaben und einzig Kampfzwecken vorbehalten, werden sie wie Wehr und Waffen für Kriege aufgespart.
30. Weiter nördlich beginnt mit dem herkynischen Walde das Land der Chatten; sie wohnen nicht in so flachen und sumpfigen Gebieten wie die übrigen Stämme, die das weite Germanien aufnimmt. Denn die Hügel dauern an und werden erst allmählich seltener, und so begleitet der herkynische Wald seine Chatten und endet mit ihnen. Bei diesem Volk sind kräftiger die Gestallten, sehnig die Glieder, durchdringend der Blick und größer die geistige Regsamkeit. Für Germanen zeigen sie viel Umsicht und Geschick: sie stellen Männer ihrer Wahl an die Spitze, gehorchen den Vorgesetzten, und kennen Reih und Glied, nehmen günstige Umstände wahr, verschieben einmal einen Angriff, teilen sich ein für den Tag, verschanzen sich für die Nacht; das Glück halten sie für Unbeständig und nur die eigene Tapferkeit für beständig. Und was überaus selten und sonst allein römischer Kriegszucht möglich ist: sie geben mehr auf die Führung als auf das Heer. Ihre Stärke liegt ganz beim Fußvolk, dem sie nicht nur Waffen, sondern auch Schanzzeug und Verpflegung aufbürden: andere sieht man in die Schlacht ziehen, die Chatten in den Krieg. Selten kommt es zu Streifzügen und nicht geplanten Kampf. Es ist ja auch die Art berittener Streitkräfte, rasch den Sieg zu erringen und rasch wieder zu entweichen; doch Schnelligkeit grenzt an Furcht, Zögern kommt standhaften Mute näher.
31. Ein Brauch, der auch bei anderen germanischen Stämmen vorkommt, jedoch selten und als Beweis vereinzelten Wagemuts, ist bei den Chatten allgemein üblich geworden: mit dem Eintritt in das Mannesalter lassen sie Haupthaar und Bart wachsen, und erst, wenn sie einen Feind erschlagen haben, beseitigen sie diesen der Tapferkeit geweihten und verpfändeten Zustand ihres Gesichtes. Über dem Blut und der Waffenbeute enthüllen sie ihre Stirn und glauben, erst jetzt die Schuld ihres Daseins entrichtet zu haben und des Vaterlandes sowie ihrer Eltern würdig zu sein. Die Feigen und Kriegscheuen behalten ihren Wust. Die Tapfersten tragen überdies einen eisernen Ring- sonst eine Schande bei diesem Stamme- wie eine Fessel, bis sie sich durch Tötung eines Feindes davon befreien. Vielen Chatten gefällt dieses Aussehen, und sie werden Grau mit ihren Kennzeichen, von Freund und Feind gleichermaßen beachtet. Sie eröffnen jeden Kampf; sie sind stets das vordere Glied, ein befremdender Anblick; denn auch im Frieden nimmt ihr Gesicht kein milderes Aussehen an. Keiner von ihnen hat Haus oder Hof oder sonstige Pflichten; wen immer sie aufsuchen, von dem lassen sie sich je nach den Verhältnissen bewirten; sie sind Verschwender fremden und Verächter eigenen Gutes, bis das kraftlose Alter sie zu so rauem Kriegerdasein unfähig macht.
32. Den Chatten zunächst, wo der Rhein noch ein festes Bett hat und als Grenzscheide genügt, wohnen die Usiper und Tenkterer. Die Tenkterer überragen den üblichen Kriegsruhm durch ihre vorzüglich geschulte Reiterei, und ebenso großes Ansehen wie das Fußvolk der Chatten genießt die Reitertruppe der Tenkterer. So führten es die Vorfahren ein und halten es auch die Nachkommen; hierin besteht das Spiel der Kinder, hierin der Wetteifer der Jugend und die ständige Übung der Alten. Wie das Gesinde, der Wohnsitz und alle Rechte der Nachfolge vererben sich auch die Pferde; ein Sohn empfängt sie, doch nicht, wie alles andere, der Erstgeborene, sondern jeweils der Streitbarste und tapferste.
33. In der Nähe der Tenkterer stieß man einst auf die Brukterer; jetzt sind, wie es heißt, die Chamaver und Angrivarier dorthin gezogen. Denn die verbündeten Nachbarstämme hatten die Brukterer geschlagen und gänzlich ausgerottet, aus Erbitterung über ihren Hochmut oder aus Beutelust oder weil die Götter uns eine Gunst erzeigten; denn sie gewährten uns sogar das Schauspiel der Schlacht. Über Sechzigtausend sind dort gefallen, nicht durch römische Wehr und Waffen, sondern, was noch erhebender ist, ganz zu unserer Augenweide. Es bleibe, so flehe ich, und bestehe fort bei diesen Völkern, wenn nicht Liebe zu uns, so doch gegenseitiger Hass; denn bei dem lastenden Verhängnis des Reiches kann das Geschick nichts besseres mehr darbieten als die Zwietracht der Feinde.
34. An die Angrivarier und Chamaver schließen sich südostwärts die Dulgubnier und Chasuarier an sowie andere, weniger bekannte Stämme; im Norden folgen die Friesen. Nach der Volkszahl unterscheidet man Groß- und Kleinfriesen. Beide Stämme werden bis zum Weltmeer hin vom Rheine eingesäumt und umgeben zudem unermessliche Seen, auf denen schon Römische Flotten gefahren sind. Ja, selbst auf das Weltmeer haben wir uns dort hinausgewagt, und wie die Kunde verbreitet, gibt es da noch Säulen des Herkules, mag der Held wirklich dorthin gelangt sein oder mögen wir uns angewöhnt haben, alles Großartige in der Welt mit seinem berühmten Namen zu verbinden. Auch hat es dem Drusus Germanicus an Wagemut nicht gefehlt, doch hat die See verhindert, dass man sich über sie und zugleich über Herkules Gewissheit verschaffe. Hiernach hat sich niemand mehr getraut, und es galt für frömmer und ehrfürchtiger, an die Taten der Götter zu glauben als von ihnen zu wissen.
35. Bis jetzt haben wir Germanien nach Westen hin kennen gelernt; nach Norden springt es in riesiger Ausbuchtung zurück. Und sogleich an erster Stelle zieht sich der Stamm der Chauken, der bei den Friesen beginnt und einen Teil der Küste besitzt, an der Seite sämtlicher von mir erwähnter Stämme hin und reicht mit einem Zipfel bis ins Land der Chatten. Dieses unermessliche Gebiet nennen die Chauken nicht nur ihr eigen, sie füllen es vielmehr auch aus, ein unter den Germanen sehr angesehener Stamm, der es vorzieht, seine Größe durch Rechtlichkeit zu behaupten. Frei von Habgier, frei von Herrschsucht, leben sie still und für sich; sie reizen nicht zum Kriege, sie gehen nicht auf Raub oder Plünderung aus. Das ist der vorzüglichste Beweis ihres Mutes und ihrer Macht, dass sie ihre Überlegenheit nicht auf Gewalttaten gründen. Doch haben alle die Waffen zur Hand, und sooft es die Not erfordert, steht ein Heer bereit, zahlreich an Männern und Pferden. Auch wenn sie Frieden haben ist ihr Ruf der gleiche.
36. Als Nachbarn der Chauken und Chatten gaben sich die Cherusker unbehelligt einem allzu langen und erschlaffenden Frieden hin. Der brachte ihnen mehr Behagen als Sicherheit; denn es ist verfehlt, unter Herrschsüchtigen und Starken der Ruhe zu pflegen. Wo das Faustrecht gilt, sind Mäßigung und Rechtschaffenheit Namen, die nur dem Überlegenen zukommen. So werden die Cherusker, die einst die guten und gerechten hießen, jetzt Tölpel und Toren genannt; den siegreichen Chatten rechnet man das Glück als Klugheit an. Der Sturz der Cherusker riss auch die Foser mit sich, einen benachbarten Stamm; im Missgeschick sind die ‚Bündner gleichen Rechts, während sie im Glück zurückstehen mussten.
37. In derselben Ausbuchtung, unmittelbar am Meere, wohnen die Kimbern, jetzt eine kleine Völkerschaft, doch gewaltig an Ruhm. Von der einstigen Geltung sind weithin Spuren erhalten, ausgedehnte Laderplätze jenseits und diesseits des Rheines, an deren Umfang man jetzt die ungeheure Arbeitskraft dieses Stammes und die Glaubwürdigkeit des großen Wanderzuges ermessen kann. Sechshundertvierzig Jahre zählte unsere Stadt, als man unter dem Konsulat des Caelius Metellus und Papirius Carbo zum ersten Male von den Waffentaten der Kimbern vernahm. Rechnen wir von da ab bis zum zweiten Konsulat des Kaisers Trajan, dann ergeben sich ungefähr Zweihundertzehn Jahre: so lange schon wird Germanien besiegt! Im Verlauf dieser langen Zeit erlitten beide Seiten schwere Verluste. Nicht der Samnite, nicht der Punier, nicht die spanischen oder die gallischen Lande, ja nicht einmal die Parther machten öfter von sich reden: stärker noch als die Königsmacht des Arsakes ist das Freiheitsstreben der Germanen. Denn was kann uns der Osten weiter vorhalten als den Untergang des Crassus? Dafür büßte er seinerseits den Parcorus ein und musste sich einen Ventidius beugen. Anders die Germanen: sie haben Carbo und Maximus Mallius geschlagen oder gefangen genommen und zugleich dem römischen Volke fünf konsularische Heere entrissen, ja sogar dem Kaiser Augustus den Varus und mit ihm drei Legionen, und nicht ohne eigene Verluste rang sie Marius in Italien, der göttliche Cäsar in Gallien, Drusus und Nero und Germanicus in ihrem eigenen Lande nieder; bald danach nahmen die ungeheueren Drohungen des Kaisers Gaius ein lächerliches Ende. Seitdem war Ruhe, bis die Germanen, unsere Zwietracht und den Bürgerkrieg ausnutzend, die Winterlager der Legionen erstürmen und selbst Gallien zu gewinnen suchten. Und nachdem sie von dort wieder vertrieben waren, hat man in jüngster Zeit Siege über sie mehr gefeiert als wirklich errungen.
Aus Tacitus Germania / Fuhrmann Manfred / Reclam
Annalen I
(14 nach Chr.)
1. Aber wahrhaftig, Germanicus, den Sohn des Drusus, machte er zum Befehlshaber über die acht Legionen, die am Rhein standen, und befahl Tiberius, ihn zu adoptieren, obgleich in der Familie des Tiberius ein jugendlicher Sohn war. Doch Augustus wollte über eine vermehrte Zahl von Stützen verfügen. Der einzige Krieg, der in dieser Zeit noch andauerte, war der gegen die Germanen; er sollte mehr die Schande des unter Quintilius Varus verlorenen Heeres tilgen als den Wunsch nach Ausdehnung des Reiches oder sonst einem den Einsatz lohnenden Preise dienen. Im Inneren war die Lage ruhig.
49. Immer noch herrschte eine wilde Erregung in der Truppe. Da wandelte sie plötzlich der Wunsch an, gegen den Feind zu ziehen, um ihre Raserei zu sühnen. Anders könnten sie die Geister der Kameraden nicht versöhnen, als wenn sie auf ihre frevelbeladene Brust ehrende Wunden empfingen. Der Caesar (Germanicus) entsprach ihrem ungestümen Drängen und setzte auf einer Schiffbrücke zwölftausend Legionssoldaten, Sechsundzwanzig Kohorten der Bundesgenossen und acht Reiterschwadronen über, die sich bei dieser Meuterei nicht gegen den Gehorsam vergangen hatte. Eine frohe Stimmung herrschte bei den Germanen, die nicht fern waren, während wir wegen des Todes von Augustus zuerst durch die Staatstrauer, dann durch die Meutereien in Anspruch genommen waren. Doch der Römer durchschritt in Eilmärschen den Caesischen Wald auf der von Tiberius begonnene Bahn, schlug auf ihr ein Lager und sicherte sich vorn und im Rücken durch einen Wall, seitlich durch Verhaue. Dann zog er durch dunkele Waldgebiete und überlegte, ob er von zwei Wegen den kurzen und üblichen oder den schwierigeren, unbegangenen und daher von den Feinden unbewachten einschlagen solle. Man wählte den längeren Weg und betrieb alles Weitere mit großer Eile. Denn Kundschafter hatten mitgeteilt, von den Germanen werde in dieser Nacht mit den üblichen Gelagen und Spielen ein Fest gefeiert. Caecina erhielt den Befehl, mit einsatzbereiten Kohorten vorauszumarschieren und den Weg durch den Wald von Hindernissen frei zu machen. Die Legionen folgten in kurzen Abstand. Eine sternhelle Nacht kam zustatten. Man kam zu den Gehöften der Marser und umstellte sie mit Feldwachen, während ihre Bewohner noch an den Lagerstätten oder an den Tischen umherlagen, ohne jede Furcht und ohne Posten ausgestellt zu haben. In solcher Sorglosigkeit lagen sie überall zerstreut umher; sie fürchteten durchaus keinen Krieg, und auch der Friede, dem sie sich träge und schlaff hingaben, war nichts anderes als die Folge ihrer Betrunkenheit. Der Caesar teilte die kampfbegierigen Legionen, um ein desto größeres Gebiet zu verwüsten in vier Kampfgruppen. Eine Strecke von fünfzig Meilen verheerte er mit Feuer und Schwert. Nicht Geschlecht, nicht Alter fand Mitleid. Privathäuser und Heiligtümer, auch der bei jenen Völkerschaften berühmte heilige Bezirk, den sie Tamfana nennen, wurden dem Erdboden gleichgemacht. Bei der Truppe gab es keine Verluste, da sie Halbschlafende und Waffenlose oder einzeln Umherstehende erschlagen hatten. Dieses Morden rief die Brukterer, Tubanten und Usipeter auf den Plan. Sie besetzten die Waldgebiete, durch die das Heer zurückmarschieren musste. Der Feldherr erfuhr dies und marschierte mit seiner Truppe in einer Formation, aus der sie jederzeit den Kampf aufzunehmen vermochte. Ein Teil der Reiterei und die Kohorten der Hilfstruppen bildeten die Spitze, dann kam die erste Legion, der Tross wurde in die Mitte genommen, während die linke Flanke von der einundzwanzigsten und die rechte von der fünften gedeckt wurde. Im Rücken sicherte die zwanzigste Legion, und hinter ihr kamen die übrigen Bundesgenossen. Aber die Feinde rührten sich nicht, solange die Kolonne in ihrer ganzen Länge zog. Dann griffen sie mit schwachen Kräften von den Seiten und von vorn an und warfen sich mit ganzer Macht auf die Nachhut. Und schon gerieten die leichten Kohorten durch den Angriff der dichten Haufen der Germanen in Unordnung, als der Caesar zu der zwanzigsten Legion herantritt und mit lauter Stimme rief:“ Jetzt ist die Zeit gekommen, die Meuterei vergessen zu machen. Marschiert weiter, verwandelt die Schuld in Ehre!“ In aufflammenden Mute durchbrachen sie in einem einzigen Ansturm den Feind, warfen ihn ins freie Gelände und machten ihn nieder. Zugleich gelangten die Truppen der Vorhut aus dem Walde heraus und schlugen ein befestigtes Lager. Von da an blieb der Marsch unbehelligt. Vertrauend auf die frischen Erfolge sowie die vergangenen Geschehnisse vergessend, wurde die Truppe in die Winterquartiere verlegt.
(15 nach Chr.)
56. So übergab denn Germanicus dem Caecina vier Legionen und fünftausend Mann Hilfstruppen sowie ein in Eile ausgehobenes Aufgebot der diesseitigen Germanen. Ebenso viele Legionen und die doppelte Zahl der Bundesgenossen führte er selbst an. Er legte auf den noch sichtbaren Resten des Stützpunktes seines Vaters auf dem Taunusgebirge ein Kastell an und eilte ohne Troß in das Gebiet der Chatten, wobei er L. Apronius zur Herstellung von Wegen und Flussübergängen zurückließ. Denn- eine Seltenheit in jenem Himmelsstrich- infolge der Trockenheit und des niedrigen Wasserstandes der Flüsse hatte er unbehindert in Eilmärschen vorrücken können, aber für den Rückmarsch befürchtete man Regengüsse und Anschwellen der Flüsse. Aber für die Chatten erschien er so überraschend, dass alles Volk, das wegen des Alters und Geschlechtes nicht wehrfähig war sofort gefangen genommen und erschlagen wurde. Die wehrfähige Mannschaft war über die Adrana (Eder) geschwommen und versuchte die Römer an dem Weiterbau einer Brücke zu hindern. Dann wurden sie durch den Einsatz von Schleudermaschinen und Pfeilschützen vertrieben, und nachdem sie vergebens versucht hatten, Friedensverhandlungen anzubahnen, ging eine Anzahl zu Germanicus über, während die übrigen ihre Dörfer und Gehöfte verließen und sich in die Wälder zerstreuten. Der Caesar steckte Mattium den Vorort ihres Volksstammes, in Brand, verwüstete das flache Land und wandte sich zum Rhein, ohne dass es der Feind gewagt hätte, die abziehende Truppe im Rücken anzugreifen, was doch sonst seine Art ist, wenn mehr List als Furcht der Grund ihres Zurückweichens gewesen ist. Die Cherusker hatten die Absicht gehabt den Chatten zu helfen. Aber Caecina schreckte sie dadurch, dass er sie bald hier, bald dort angriff. Und die Marser, die den Mut gehabt hatten, sich zum Kampf zu stellen, wies er durch ein erfolgreiches Gefecht in die Schranken.
57. Bald darauf kamen Gesandte von Segestes mit der Bitte, ihm gegen die Gewalttätigkeit seiner Landsleute, von denen er belagert wurde, zu helfen. Arminius hatte bei ihnen größeren Einfluss, weil er zum Kriege riet. Denn bei den Barbaren richten sich das Vertrauen, dass man einem Mann entgegenbringt, und sein Einfluss in bewegten Zeiten nach seinem Wagemut und seiner Entschlossenheit. Den Gesandten hatte Segestes seinen Sohn, namens Segimundus, beigegeben. Aber der junge Mann zögerte aus Schuldbewusstsein. Denn in dem Jahre, als Germanien abfiel, hatte er, in Ara Ubiorum zum Priester gewählt, seine Priesterbinden zerrissen und war zu den Meuterern geflüchtet. Doch die Hoffnung auf die römische Milde veranlassten ihn, die Aufträge seines Vaters zu überbringen. Er fand eine freundliche Aufnahme und wurde unter Bedeckung zum gallischen Ufer geschickt. Germanicus hielt es für lohnend kehrtzumachen. Es kam zu einen Kampf mit den Belagerern, und Segestes wurde mit zahlreichen Verwandten und Klienten befreit. Darunter waren vornehme Frauen, auch die Gattin des Arminius, die ja die Tochter des Segestes war und mit dem Herzen mehr auf der Seite ihres Mannes als ihres Vaters stand. Sie ließ sich keinen Träne entlocken und ließ kein demütiges Wort verlauten; die Hände unter dem Bauch ihres Kleides gefaltet, schaute sie auf ihren schwangeren Leib. Es kamen auch Rüstungen aus der Niederlage des Varus zum Vorschein, die den Männern, die sich jetzt ergaben, meistenteils als Beutestücke gegeben worden waren; Zugleich erschien Segestes selbst, der, eine riesige Erscheinung, im Bewusstsein seiner guten Bundesgenossenschaft ganz ohne Furcht war.
58. Er sprach etwa folgendermaßen: „Dies ist für mich nicht der erste Tag, an dem ich meine unverbrüchliche Treue gegenüber dem römischen Volk zeige. Seitdem ich von dem vergöttlichtem Augustus mit dem Bürgerrecht beschenkt worden bin, bestimmte euer Nutzen, wen ich als Freund und wen ich als Feind auserlas, und zwar nicht aus Hass gegen mein Vaterland- die Verräter sind ja auch denen, auf deren Seite sie sich stellen verhasst-, sondern weil ich der Überzeugung war, dass der Vorteil der Römer auch der der Germanen ist, und weil ich den Frieden besser als den Krieg hielt. Deshalb habe ich den Räuber meiner Tochter, der den Vertrag mit euch gebrochen hat, bei Varus, dem damaligen Befehlshaber des Heeres, angeklagt. Hingehalten durch die Saumseligkeit des Heerführers, habe ich, weil die Gesetze keinen richtigen Rückhalt boten, dringend gefordert, mich, Arminius und die in das Komplott Eingeweihten in Fesseln zu legen. Zeuge ist jene Nacht. Wäre sie doch lieber die letzte gewesen! Was dann folgte, kann man zwar beweinen aber nicht rechtfertigen. Jedoch habe ich Arminius in Ketten gelegt und habe solche meinerseits von seiner Partei erdulden müssen. Doch bei der ersten Gelegenheit, mit dir in Verbindung zu treten, gebe ich das Neue gegen das Alte hin, den Geist des Aufruhrs gegen den des Friedens, aber nicht in Erwartung einer Belohnung, sondern um mich der Rolle des Treulosen zu entledigen und dafür die des geeigneten Vermittlers für das germanische Volk zu übernehmen, falls es die Reue dem Verderben vorziehen sollte. Für die Jugendbedingte Verwirrung meines Sohnes bitte ich um Nachsicht. Dass meine Tochter mit Gewalt hierher gebracht worden ist, gestehe ich. Deine Sache wird es sein, zu beurteilen, was größeres Gewicht hat, dass sie ein Kind von Arminius bekommt oder dass sie meine leibliche Tochter ist.“ Der Caesar gab einen entgegenkommenden Bescheid, in dem er seinen Kindern und Verwandten versprach, es werde ihnen nichts geschehen, und ihm selbst einen Wohnsitz in der alten Provinz zusicherte. Sein Heer führte er zurück und nahm auf Anweisung des Tiberius den Titel Imperator an. Die Gattin des Arminius gebar einen Spross männlichen Geschlechts. Der Knabe wuchs in Ravenna auf. Von dem Spiel, dass das Schicksal später mit ihm getrieben hat, werde ich zu gegebener Zeit berichten.
59. Die Kunde von der Unterwerfung des Segestes und von seiner freundlichen Aufnahme wurde, je nach dem die Stimmung für oder gegen den Krieg war, mit Hoffnung oder mit Bedauern aufgenommen. Abgesehen von seiner angeborenen Leidenschaftlichkeit, trieb Arminius der Gedanke an den Raub seiner Gattin, an ihre Schwangerschaft, während der sie in der Sklaverei schmachtete, wie im Wahnsinn um. Er jagte in dem Cheruskerland umher und forderte Waffen gegen Segestes, Waffen gegen den Caesar. Auch mit Beschimpfungen sparte er nicht. Das sei ein hervorragender Vater, ein großer Imperator, ein tapferes Heer, das mit so vielen Händen ein einziges schwaches Weib fortgeschleppt habe. Vor ihm seien drei Legionen und ebenso viele Legaten auf die Knie gesunken. Nicht mit Verrat , nicht gegen schwangere Frauen führe er Krieg, sondern offen gegen einen bewaffneten Feind. Immer noch sehe man in den Hainen der Germanen die römischen Feldzeichen, die er als Weihgabe an die heimischen Götter aufgehängt habe. Möge Segestes das unterworfene Ufergebiet bewohnen, seinem Sohn wieder das Priesteramt verschaffen: die Germanen werden nie sich damit abfinden, dass sie zwischen Elbe und Rhein Rutenbündel, Beile und die Toga gesehen haben. Andere Völkerschaften, die keine Bekanntschaft mit dem römischen Reich gemacht haben, wissen nichts von Blutgerichten und kennen keine Steuern. Diese Lasten hätten sie ja abgeschüttelt, und jener unter die Götter versetzte Augustus, jener als sein Nachfolger auserlesene Tiberius seien unverrichteter Dinge abgezogen. Darum sollten sie auch nicht jetzt vor einem unerfahrenen, ganz jungen Mann, vor einem meuternden Heer in Angst geraten. Wenn ihnen Vaterland, Eltern, die alten Verhältnisse höher stehen als Zwingherrn und neue Ansiedlung, sollten sie lieber dem Arminius, dem Führer zu Ruhm und Freiheit, als dem Segestes, dem Führer zu schändlicher Knechtschaft folgen.
60. Dadurch wurden nicht nur die Cherusker, sondern auch die angrenzenden Völkerschaften aufgewiegelt und Inguiomerus, der Oheim des Arminius, der bei den Römern seit langem in Ansehen stand, zum Anschluss bewogen. So wuchs die Besorgnis des Caesar. Und damit nicht die ganze Wucht des Krieges auf einmal hereinbreche, schickte er Caecina mit vierzig römischen Kohorten, um den Feind zu zersplittern, durch das Gebiet der Brukterer an den Fluss Amisa (Ems), während die Reiterei der Befehlshaber Pedo durch das Gebiet der Friesen führte. Er selbst fuhr mit vier Legionen, die er auf Schiffe verladen hatte, über die Seen. Fußvolk Reiterei und Flotte trafen gleichzeitig an dem vorbestimmten Fluss ein. Da die Chauken Hilfstruppen zu stellen versprachen, wurden sie in die Heergemeinschaft aufgenommen. Die Brukterer, die selbst ihr Hab und Gut verbrannten, schlug L. Stertinius, den Germanicus mit einer leichten Heeresabteilung abgesandt hatte. Während des Mordens und Plünderns fand er den Adler der neunzehnten Legion, der unter Varus verloren gegangen war. Dann führte er das Heer weiter bis zu den äußersten Grenzen der Brukterer, und das ganze Gebiet zwischen den Flüssen Amisa und Lupia, nicht weit von dem Teutoburger Wald, in dem, wie es hieß, die Überreste des Varus und seiner Legionen unbegraben lagen, wurde verwüstet.
61. Nun erwachte in dem Caesar das verlangen, jenen Soldaten und ihrem Heerführer die letzte Ehre zu erweisen, wobei das ganze anwesende Heer von schmerzlichen Mitgefühl erfüllt war wegen der leidvollen Kriege und des menschlichen Loses. Caecina wurde vorausgeschickt, um die entlegenen Waldgebiete zu durchforschen und über das sumpfige Gelände und den Trügerischen Moorboden Brücken und Dämme zu führen. Und nun betraten sie die Unglücksstätte, grässlich anzusehen und voll schrecklicher Erinnerungen. Das erste Lager des Varus wies an seinem weiten Umfang und der Absteckung des Hauptplatzes auf die Arbeit von drei Legionen hin. Dann erkannte man an dem halb eingestürzten Wall und dem niedrigen Graben, dass die schon zusammengeschmolzenen Reste sich dort gelagert hatten. Mitten im freien Feld lagen die Gebeine zerstreut oder in Haufen, je nachdem die Leute geflohen waren oder widerstand geleistet hatten. Dabei lagen Bruchstücke von Waffen und Pferdegerippe, zugleich fanden sich an Baumstämme angenagelte Köpfe. In den benachbarten Hainen standen die Altäre der Barbaren, an denen sie die Tribunen und die Centurionen der ersten Rangstufe geschlachtet hatten. Die Leute, die diese Niederlage überlebt hatten und der Schlacht oder der Gefangenschaft entronnen waren, erzählten, hier seien die Legaten gefallen, dort die Adler von den Feinden erbeutet worden; sie zeigten, wo Varus die erste Wunde erhalten, wo er mit seiner unseligen Rechten sich selbst den Todesstoss beigebracht habe; wo Arminius von der Tribüne herunter eine Ansprache gehalten habe, wie viele Galgen für die Gefangenen, was für Martergruben er habe herstellen lassen, wie er die Feldzeichen und Adler übermütig verhöhnt habe.
62. Und nun setzte das hier befindliche römische Heer, sechs Jahre nach der Niederlage, die Gebeine von drei Legionen bei, in trauriger Stimmung und zugleich in wachsenden Zorn auf den Feind, ohne das jemand erkannte, ob er die Überreste von Fremden oder von seinen eigenen Angehörigen in der Erde barg. Und es war, als ob sie alle zusammengehörten, als ob sie Blutsverwandte seien. Das erste Rasenstück zur Aufschichtung des Hügels legte der Caesar als willkommensten Liebesdienst für die Toten und als Zeichen seiner Anteilnahme an den Schmerz der Anwesenden. Dies fand jedoch nicht die Billigung des Tiberius, mag er nun alle Handlungen des Germanicus übel ausgelegt haben oder glaubte er, das Heer sei durch den Anblick der Erschlagenen und Unbegrabenen in seinem Kampfesmut geschwächt worden und fürchte sich nunmehr vor den Feinden. Der Oberfeldherr, der das Amt des Augurn versehe und uralte religiöse Handlungen zu verrichten habe, hätte nicht an einer Leichenbestattung teilnehmen dürfen.
63. Aber Germanicus folgte dem Arminius, der sich in unwegsame Gegenden zurückzog, und befahl der Reiterei, sobald sich Gelegenheit dazu bot, vorzustürmen und dem Feind ein freies Feld, dass er besetzt hatte, zu entreißen. Arminius forderte seine Leute auf, sich zusammenzuscharen und an das Waldgelände heranzurücken. Dann machte er plötzlich kehrt und gab den Abteilungen, die er überall im Waldgebiet versteckt hatte, das Zeichen zum Hervorbrechen. Jetzt wurde durch die neue Kampffront unsere Reiterei in Verwirrung gebracht, und die herbei geschickten Reservekohorten, auf die der Strom der Fliehenden prallte, vermehrten noch die Bestürzung. Sie wären in das Sumpfgelände, in dem sich die Siegenden auskannten, während es für die Unkundigen gefährlich war, gedrängt worden, hätte nicht der Caesar die Legionen vorgeführt und zum Kampf aufgestellt. Dies erschreckte den Feind und ermutigte die eigene Truppe. Doch ohne dass es zu einer Entscheidung kam, trennte man sich. Dann führte er das Heer an die Amisa zurück und brachte die Legionen zu Schiff wie er sie hergeführt hatte, wieder zurück. Einem Teil der Reiterei befahl er, entlang der Küste zum Rhein zu marschieren. Caecina, der einen eigene Heeresabteilung führte, erhielt die Weisung, obgleich die Wege, auf denen er den Rückmarsch antreten wollte, bekannt waren, so rasch wie möglich die „Langen Brücken“ hinter sich zu bringen, dies ist ein schmaler Fußpfad durch ausgedehntes Sumpfgelände, der einst von L. Domitius als Damm aufgeführt worden war. Das übrige Gelände ist morastig, man bleibt dort im schweren Lehmboden hängen, oder Bachläufe machen es nur schwer begehbar. Ringsum stieg das Waldgelände langsam an, das Arminius jetzt besetzte, nachdem er in Eilmärschen auf abgekürzten Wegen dem mit seinem Gepäck und mit Waffen belasteten römischen Heer zuvorgekommen war. Caecina der unschlüssig war, wie er die im Laufe der Zeit zusammengebrochenen Bohlenwege wiederherstellen und zugleich den Feind abwehren solle, beschloss an Ort und Stelle ein Lager abzustecken, damit der eine Teil mit der Befestigungsanlage beginnen, der andere den Kampf aufnehmen könne.
64. Die Barbaren versuchten die Postenkette zu durchbrechen und sich auf die Arbeitskommandos zu stürzen; sie forderten sie heraus, umzingelten sie und stürmten auf sie los. Durcheinander ertönte das Geschrei der Arbeitskommandos und der kämpfenden Truppe. Und überall stellten sich die gleichen Schwierigkeiten den Römern in den Weg: Das grundlose Sumpfgelände, auf dem man nicht fest auftreten konnte und beim Vorwärtsgehen ausglitt, das Gewicht der Panzer, das auf dem Körper lastete, die Unmöglichkeit, im Wasser stehend die Wurfspeere zu schwingen. Dagegen waren die Cherusker an den Kampf im Sumpfgelände gewöhnt, waren hochgewachsen, führten gewaltige Lanzen, mit denen sie auch auf größere Entfernung ihre Gegner verwunden konnten. Erst die Nacht enthob die schon weichenden Legionen dem unter ungünstigen Bedingungen geführten Kampfe. Die Germanen kannten angesichts ihrer Erfolge keine Müdigkeit. Sie gönnten sich auch jetzt keine Ruhe und leiteten alle Wasserläufe, die von den Anhöhen ringsum herunter kamen, in das tieferliegende Gelände ab. Dieses wurde überschwemmt und die schon fertig gestellten Befestigungsabschnitte verschüttet, wodurch die Mannschaften doppelte Arbeit zu leisten hatten. Es war das vierzigste Dienstjahr, in dem Caecina als Untergebener oder Vorgesetzter stand. Er hatte Erfahrung im Glück und im Unglück gesammelt und ließ sich daher nicht in Schrecken versetzen. Und so fand er bei der Erwägung, welche Maßnahmen zu treffen seien, keinen anderen Ausweg, als den Feind aus dem Walde solange nicht heraus zu lassen, bis die Verwundeten und der ganze schwere Tross einen Vorsprung gewonnen hätten. Denn in der Mitte zwischen den Bergen und den Sümpfen zog sich eine Ebene hin, die eine Aufstellung in schmaler Front ermöglichte. Von den Legionen wählte er die fünfte für die rechte, die einundzwanzigste für die linke Flanke, die erste für die Spitze der Marschkolonne, die zwanzigste als rückwärtige Deckung gegen etwaige Verfolgung aus.
65. In der Nacht kam es aus verschiedenen Ursachen zu keiner Ruhe: die Talmulden und die widerhallenden Bergwälder waren erfüllt von dem fröhlichen Gesang oder dem wilden Lärmen der Barbaren, die festliche Gelage feierten; bei den Römern glimmten nur schwache Lagerfeuer, hörte man nur abgebrochene Laute, während sie selbst an dem Wall herumlagen, in den Zelten umherirrten, mehr weil sie nicht Schlafen konnten, als weil sie wachen wollten. Den Heerführer erschreckte ein grässliches nächtliches Traumbild: er glaubte den blutbespritzten Quintilius Varus aus dem Sumpfgelände emportauchen zu sehen und ihn gleichsam rufen zu hören, ohne ihm jedoch Folge zu leisten; vielmehr stieß er die ausgestreckte Hand zurück. Bei Tagesanbruch verließen die zum Flankenschutz abgesandten Legionen aus Furcht oder Widersetzlichkeit ihre Stellung und besetzten eilig das freie Feld jenseits des Sumpfgeländes. Aber Arminius brach nicht sofort hervor, obgleich seinem Angriff nichts entgegengestanden hätte. Als aber der Tross im Schlamm und in den Gräben stecken blieb, überall bei den Soldaten Verwirrung um sich griff, die einzelnen Abteilungen nicht mehr geschlossen blieben und, wie es in einer solchen Lage zu gehen pflegt, jeder nur darauf bedacht war, rasch davonzukommen, und sich taub gegen Befehle stellte, da gab Arminius den Germanen den Befehl zum Angriff mit dem Ruf: „Seht da! Varus und die wiederum dem gleichen Schicksal verfallenen Legionen!“ Mit diesen Worten durchbrach er mit einer auserlesenen Truppe die Marschkolonne, wobei er hauptsächlich den Pferden Wunden beibrachte. Diese glitten in ihrem eigenen Blute und auf dem schlüpfrigen Sumpfboden aus, warfen die Reiter ab, trieben die Leute vor ihnen auseinander und zerstampften die am Boden liegenden. Der Kampf tobte hauptsächlich um die Adler, die weder gegen den Geschosshagel vorwärts getragen noch in dem schlammigen Boden festgemacht werden konnten. Während Caecina versuchte, den Kampf zum stehen zu bringen, wurde sein Pferd unter ihm durchstochen. Er stürzte herab und währe umzingelt worden, wenn nicht die erste Legion sich dem Feind entgegen geworfen hätte. Dabei kam die Habgier der Feinde zustatten, die von dem Morden abließen und sich auf das Beutemachen verlegten. So konnten sich die Legionen, als es Abend wurde, in offenes Gelände und auf festen Boden herausarbeiten. Doch damit war die Not noch nicht zu Ende: es musste ein Wall errichtet und Dammerde herbeigeschafft werden. Die Geräte für das Ausheben der Erde oder Ausstechen des Rasens waren größtenteils verloren gegangen, die Manipel hatten keine Zelte, für die Verwundeten gab es keine Verbandstoffe, die Nahrungsmittel, die man verteilte, waren durch Schmutz oder Blut verunreinigt, und die Soldaten jammerten über die Grabesnacht und dass so viele tausend Menschen nur noch einen einzigen Tag zu leben hätten.
66. Zufällig riss sich ein Pferd von seinen Fesseln los, rannte, durch das Geschrei scheu geworden, umher und warf einige Leute um, die ihm in den Weg kamen. Man glaubte an einen Überfall der Germanen, und so kam es zu einer solchen Panik, dass alle zu den Toren stürzte, und zwar hauptsächlich zu dem rückwärts gelegenen Tor, das, vom Feinde abgelegen, den Fliehenden größere Sicherheit bot. Als Caecina feststellte, dass kein Grund zur Angst vorliege, er selbst jedoch weder durch sein Ansehen noch durch Bitten, ja nicht einmal durch tätliches Eingreifen dagegen etwas ausrichten oder die Mannschaften zurückhalten konnte, warf er sich auf die Schwelle des Tores. Erst in dem er Mitleid erweckte, sperrte er den Weg, da man über den Körper des Legaten hätte gehen müssen. Zugleich klärten die Tribunen und Centurionen die Leute darüber auf, dass es blinder Alarm sei.
67. Dann ließ er alle auf dem Hauptplatz antreten, forderte sie auf, seine Worte still anzuhören, und legte ihnen dar, was in der augenblicklichen Lage unbedingt erforderlich sei. Allein von den Waffen hätten sie Rettung zu erhoffen, jedoch müssten sie diese mit vorsichtiger Überlegung gebrauchen. Man solle innerhalb des Walles bleiben, bis die Feinde in der Hoffnung, ihn zu erstürmen, näher heranrückten. Dann müsse man von allen Seiten einen Ausfall machen, wodurch man sich bis zum Rhein durchschlagen könne. Wenn sie fliehen, harren ihrer noch mehr Wälder, noch grundlosere Sümpfe und die Grausamkeit der Feinde. Aber wenn sie Siegen, werden ihnen Ehre und Ruhm zuteil. Auch auf ihre Lieben in der Heimat und auf ihre Soldatenehre wies er sie hin. Von der schwierigen Lage schwieg er. Dann übergab er die Pferde, zuerst seine eigenen, dann die der Legaten und Tribunen ohne Ansehen der Person den tapfersten Kämpfern, damit diese zuerst zu Pferd und nach ihnen die Mannschaften zu Fuß auf den Feind losstürmen.
68. Nicht geringe Unruhe herrschte bei den Germanen. Zuversicht und Kampflust erfüllten sie, während ihre Führer uneins waren. Arminius riet, die Feinde abziehen zu lassen und sie dann wieder in dem sumpfigen, unwegsamen Gelände zu umzingeln, während Inguiomerus für ein energischeres Vorgehen, dass bei den Barbaren freudigen Anklang fand, eintrat und den Wall umzingeln und erstürmen wollte. Dies werde keine Mühe machen. Die Zahl der Gefangenen werde größer und die Beute unbeschädigt sein. Deshalb schütteten sie bei Tagesanbruch die Gräben zu, warfen Flechtwerk hinein und kletterten auf die Wallhöhe, auf der sich nur vereinzelte Leute zeigten, die vor Angst wie gelähmt waren. Als sie nun an den Befestigungen hingen, wurde den Kohorten unter dem Schmettern der Hörner und Trompeten das Zeichen zum Angriff gegeben. Mit Geschrei stürmten sie los und fassten die Germanen im Rücken, ihnen höhnisch zurufend: „Hier gibt es nicht Wälder noch Sümpfe; beiden Parteien bietet das Gelände, bieten die Götter die gleichen Möglichkeiten, sich zu bewähren!“ Der Feind, der dachte, die Vernichtung der Römer würde keine Mühe machen, auch handele es sich nur um wenige unbewaffnete Leute, wurde von dem Schmettern der Trompeten, dem Blitzen der Waffen, je weniger sie darauf gefasst waren, um so stärker betroffen. Und wie sie in günstiger Lage kampfbegierig losstürmten, so fielen sie jetzt in ungünstiger ohne alle Vorsicht. Arminius verließ unversehrt, Inguiomerus schwer verwundet das Kampffeld. Das Blutbad unter den Mannschaften hielt an, bis die Wut gestillt und der Tag zu Ende war. Erst bei Nacht kehrten die Legionen zurück. Zwar hatten sie noch mehr Verwundete als zuvor und litten unter dem gleichen Mangel an Lebensmitteln, doch der errungene Sieg ersetzte ihnen alles: Kraft, Gesundheit, Vorräte.
69. Inzwischen hatte sich das Gerücht verbreitet, das Heer sei aufgerieben und die Germanen ziehen zum Angriff auf Gallien heran. Und hätte nicht Agrippina den Abbruch der Rheinbrücke verhindert, hätten sich Leute gefunden, die zu diesem frevelhaften Tun aus Angst bereit waren. Aber die willensstarke Frau übernahm in diesen Tagen die Aufgaben des Heerführers und verteilte an alle bedürftigen Soldaten Kleidungsstücke und Verbandmittel. C. Pilinus, der Geschichtsschreiber der Germanenkriege überliefert, sie habe vorn an der Brücke gestanden und Lob und Dank den zurückkehrenden Legionen gesagt. Dies versetzte Tiberius in tiefe Unruhe. Solche Formen der Fürsorge seien nicht harmlos, und es seien nicht die auswärtigen Feinde, gegen die sich die Bemühungen um die Sympathie der Soldaten richten. Nichts mehr haben die Oberbefehlshaber zu tun und zu sagen, wenn eine Frau die Manipel musterte, sich zu den Feldzeichen stellte, es mit Schenkungen versuche, als ob es nicht genug des Buhlens um Gunst wäre, wenn sie den Sohn des Heerführers in Soldatentracht umhertrage und ihn Caesar Caligula genannt wissen wolle. Schon gelte Agrippina mehr bei den Heeren mehr als die Legaten, als die Heerführer. Eine Frau habe eine Meuterei erstickt, der der Name des Princeps nicht habe Einhalt gebieten können. Seianus schürte das Feuer und verschärfte die Lage. Er kannte den Charakter des Tiberius und säte den Hass, auf lange Zeit berechnet, aus. Tiberius sollte den Hass in seinem Herzen bewahren, um ihn dann vervielfacht hervorbrechen zu lassen.
70. Aber Germanicus übergab von den Legionen, die er zu Schiff herbeigeführt hatte, die zweite und die vierzehnte dem P. Vitellius mit dem Befehl, sie auf dem Landweg weiterzuführen, damit die Flotte mit geringerer Belastung auf dem seichten Meere weiterfahre oder auch bei Ebbe nicht so sehr festsitze. Zuerst marschierte Vitellius ungestört auf trockenem Boden oder nur bei niederem Wasserstand zur Flutzeit. Dann wurde mit dem Aufkommen eines starken Nordwindes- es war die Zeit der Tagundnachtgleiche, wo der Ozean stark anschwillt- die Marschkolonne mit fortgerissen. Das Land wurde überflutet. Meer, Strand und Niederungen boten das gleiche Bild; unsicheren und festen Boden, seichte und tiefe Stellen konnte man nicht mehr unterscheiden. Die Leute wurden von den Fluten umgeworfen, von den Strudeln verschlungen: Zugtiere; Gepäck, Leichen schwammen umher, trieben ihnen entgegen. Die Manipel kamen durcheinander, da sie bald bis zur Brust, bald bis zum Mund im Wasser standen, bisweilen auch den Boden unter den Füßen verloren, und auseinander gerieten oder untergingen. Kein Zuruf, kein gegenseitiger Zuspruch half gegen die anstürmende Wasserflut. Es machte keinen Unterschied, ob einer mutig oder feig, besonnen oder unbesonnen war, ob er überlegte oder sich dem Zufall überließ, alles wurde mit gleicher Gewalt fortgerissen. Endlich arbeitete sich Vitellius auf ein höher gelegnes Gelände hinauf, auf das er die Kolonne führte. Dort übernachteten sie ohne Lebensmittel, ohne Feuer, zum großen Teil ohne Kleidung oder mit zerschundenem Körper, in einem nicht minder bejammerwerten Zustand, als wenn sie vom Feind eingeschlossen wären. Denn in diesem Fall besteht wenigstens die Möglichkeit, ehrenvoll zu sterben, während hie nur ein unrühmlicher Untergang bevorstand. Bei Tagesanbruch sah man wieder die Erde, und der Marsch ging weite bis zur Visurgis (die Elbe), wohin Germanicus mit der Flotte gefahren war. Dann wurden die Legionen eingeschifft, während sich das Gerücht verbreitete, sie seien ertrunken. Und nicht eher glaubte man an die Rettung, als man den Caesar mit seiner Flotte zurückgekehrt sah.
71. Schon hatte Stertinius, der vorrausgeschickt worden war, um die Unterwerfung des Segimerus, des Bruders des Segestes, entgegenzunehmen, diesen selbst und seinen Sohn in die Stadt der Ubier verbracht. Beiden wurde Verzeihung gewährt, ohne weiteres Segimerus, zögernder seinem Sohn, weil es hieß, er habe den Leichnam des Quintilius Varus verhöhnt. Übrigens boten Gallien, Spanien, Italien, um die Verluste des Heeres zu ergänzen, um die Wette das Kriegsmaterial an, über das jedes Land verfügte: Waffen, Pferde, Gold. Germanicus lobte ihren Eifer, nahm jedoch nur Waffen und Pferde für die Kriegsführung an und half den Soldaten mit seinem eigenen Gelde. Um die Erinnerung an das Unglück auch durch Leutseligkeit zu mildern, besuchte er die Verwundeten, rühmte die Taten jedes einzelnen, sah sich die Wunden an und stärkte bei den einen die Aussicht auf Beförderung, bei den anderen durch die Erwähnung ihres rühmlichen Verhaltens, bei allen miteinander durch seinen Zuspruch und seine Fürsorge das Vertrauen zu seiner Person und den Mut für den weiteren Kampf.
Annalen II
(16 nach. Chr.:)
5. Übrigens kam es dem Tiberius nicht ungelegen, dass im Orient Unruhen ausbrachen. Er wollte unter diesem Vorwand Germanicus von seinen vertrauten Legionen entfernen und ihn über neue Provinzen setzen, um ihn so der Hinterlist und zugleich gefährlichen Zufällen auszusetzen. Doch je lebhafter sich ihm die Sympathien der Soldaten zuwandten und je stärker die Abneigung seines Oheims gegen ihn wuchs, um so mehr war er darauf bedacht, den Sieg zu beschleunigen. Und so beschäftigte er sich mit Plänen für kommende Schlachten und mit all den schrecklichen oder auch glücklichen Ereignissen während der verflossenen zwei Kriegsjahre: Die Germanen werden in der offenen Feldschlacht und auf normalen Gelände besiegt, aber es kommen ihnen zustatten Wälder und Sümpfe, ein kurzer Sommer und ein frühzeitiger Winter. Seine eigenen Mannschaften leiden nicht so sehr durch Verwundungen als durch weite Märsche und die Einbuße von Waffen. Gallien sei erschöpft durch die Lieferung von Pferden. Die lange Trosskolonne verlocke zu Überfällen und könne nur schwer verteidigt werden. Wenn er jedoch auf das Meer gehe, habe er auf diesem Gebiet freie Bahn, während sich die Feinde dort nicht auskennen. Zugleich könne man den Krieg früher beginnen und die Legionen gleichzeitig mit dem Nachschub befördern. Ungeschwächt werde die Reiterei mit ihren Pferden nach dem Transport von den Flussmündungen aus auf dem Wasserweg mitten nach Germanien gelangen.
6. Diese Erwägungen bestimmten ihn nun zu folgenden Maßnahmen. P.Vitellius und C.Antius wurden abgeschickt, um die Steuererhebung in Gallien durchzuführen. Indessen erhielten Silius, Anteius und Caecina den Auftrag, eine Flotte zu bauen. Tausend schleunigst gebaute Schiffe schienen ausreichend zu sein. Ein Teil war kurz mit schmalen Vorder- und Hinterdeck und weitem Bauch, um leichter der Flut standzuhalten. Manche hatten platte Kiele. Um ohne Beschädigung auf Grund laufen zu können; ein größere Anzahl war mit Steuerrudern vorne und hinten ausgerüstet, um die Ruder plötzlich zu wenden und mit der einen oder anderen Seite landen zu können. Viele hatten Brückenüberbauten, auf denen man Geschütze bewegen konnte. Sie waren zugleich für den Transport von Pferden und Kriegsbedarf geeignet. Mit leicht zu handhabenden Segelwerk und mit schnellbeweglichen Rudern ausgerüstet, wuchsen sie dank dem freudigen Einsatz der Soldaten heran und boten einen furchterregenden Anblick. Die Insel der Bataver war als Sammelpunkt bestimmt wegen ihrer guten Landemöglichkeiten und weil sie sich zur Aufnahme von Vorräten und zur Verlegung des Kriegschauplatzes eignete. Denn der Rhein, der bis dorthin in einem einheitlichen Strombett fließt oder sich um kleine Inseln herumwindet, teilt sich bei seinem Eintritt in das Bataverland gleichsam in zwei Flüsse, aber behält auf der Germanischen Seite seinen Namen wie auch seine Strömung bei, bis er sich mit dem Ozean vereinigt. An dem gallischen Ufer fließt er breiter und ruhiger (mit geänderten Namen nennen ihn die Bewohner Vahlis), dann vertauscht er auch diesen Namen mit dem Flusse Mosa, und mit ihm zusammen mündet er in gewaltiger Breite in den Ozean.
7. Aber während die Schiffe herangeführt wurden, befahl Germanicus dem Legaten Silius, mit einer leicht beweglichen Truppe in das Land der Chatten einzufallen. Er selbst führte auf die Nachricht, das an dem Flusse Lupia angelegte Kastell werde belagert, sechs Legionen dorthin. Doch konnte Silius wegen plötzlicher Regenfälle nichts weiter ausrichten. Er konnte nur unbedeutende Beute und die Gattin des Chattenfürsten Arpus mit ihrer Tochter entführen. Und auch dem Caesar gaben die Belagerer keine Gelegenheit zu einem Kampfe. Sie verschwanden bei der Kunde von seinem Erscheinen. Jedoch hatten sie den erst kürzlich für die Legionen des Varus errichteten Grabhügel und einen früher für Drusus gebauten Altar zerstört. Diesen stellte der Princeps wieder her und veranstaltete selbst an der Spitze der Legionen einen Vorbeimarsch. Den Hügel zu erneuern hielt er nicht für angebracht. Das ganze Gebiet zwischen dem Kastell Aliso und dem Rhein wurde mit neuen Grenzwegen und Dämmen befestigt.
8. Schon war die Flotte angekommen. Der Caesar hatte die Verpflegung vorausgesandt, die Legionen und die Bundesgenossen auf die Schiffe verteilt und war in den nach Drusus benannten Kanal eingelaufen, wobei er zu seinem Vater betete, er möge ihm, da er jetzt das gleiche Wagnis auf sich nehme, huldreich und gnädig mit seinem Vorbild und dem Gedenken an seine Maßnahmen und Bauten zur Seite stehen. Von hier aus fuhr er durch die Seen und den Ozean bis zur Amisa in günstiger Fahrt. Die Flotte blieb auf dem linken Flussbett der Amisa zurück. Dabei beging er den Fehler, dass er sie nicht Flussaufwärts fahren ließ. Er brachte die Truppe über den Fluss hinüber, da sie in die rechts gelegen Gebiete marschieren sollte. So wurden mehrere Tage auf den Bau von Brücken verwendet. Die Reiterei und die Legionen zogen zwar unerschrocken durch die ersten Niederungen, solange die Flut noch nicht stieg, jedoch die Nachhut, die aus Hilfstruppen bestand, einschließlich der dazugehörigen Bataver, kam, als sie in das Wasser sprangen und ihre Schwimmkunst zeigten, in Unordnung, wobei auch einige ertranken. Während der Cäsar ein Lager abstecken ließ, wurde in seinem Rücken der Aufstand der Angrivarier gemeldet: er schickte Stertinius mit Reiterei und einer leichtbewaffneten Truppe sofort dahin und bestrafte mit Feuer und Schwert die Treulosigkeit.
9. Der Strom Visurgis (Weser) floss zwischen den Römern und Cheruskern. An ihrem Ufer stellte sich Arminius mit den anderen Häuptlingen auf und fragte, ob Germanicus gekommen sei. Als er die Antwort erhielt, er sei da, bat er um die Erlaubnis, mit seinem Bruder zu sprechen. Dieser befand sich bei dem römischen Heer, wo er den Beinamen Flavus führte, sich durch Treue auszeichnete und wenige Jahre vorher unter der Heerführung des Tiberius durch eine Verwundung ein Auge verloren hatte. Die Erlaubnis wurde erteilt; er trat vor und wurde von Arminius begrüßt. Dieser schickte sein Gefolge weg und verlangte, dass die an unserem Ufer aufgestellten Bogenschützen sich entfernen. Als dies geschehen war, fragte er seinen Bruder, wovon sein entstelltes Gesicht herrühre. Als ihm dieser den Ort und die Schlacht angab, fragte er weiter, was er denn für eine Belohnung erhalten habe. Flavus wies auf eine Erhöhung des Soldes, auf eine Halskette, auf einen Ehrenkranz sowie auf andere militärische Geschenke hin, die Arminius als armseligen Sklavenlohn verspottete.
10. Dann entspann sich ein Wortwechsel: der eine sprach von der Größe Roms, von der Macht des Caesars und der schweren Bestrafung, die die Besiegten zu erwarten hätten, während dem der sich unterwerfe, Milde zuteil werde. Weder seine Gattin noch sein Sohn werden als Feind behandelt. Der andere sprach von der heiligen Pflicht gegenüber dem Vaterland, von der von den Vätern ererbten Freiheit, von den heimischen Göttern Germaniens, von der Mutter, die sich seinen Bitten anschließe. Er solle nicht zum abtrünnigen Verräter an seinen ferneren und näheren Verwandten, ja an seinem eigenen Volke, vielmehr dessen Heerführer werden. Dann kam es allmählich zu einer richtigen Zankerei, und nicht einmal der Fluss, der sie trennte, hätte sie daran gehindert, miteinander handgemein zu werden, wenn nicht Stertinius herbeigeeilt wäre und Flavus, der wutentbrannt Waffen und ein Pferd forderte, festgehalten hätte. Auf der Gegenseite sah man Arminius, der unter Drohungen eine Schlacht ankündigte. Dabei gebrauchte er sehr viele lateinische Ausdrücke. Er hatte ja im römischen Feldlager als Führer seiner Landsleute gedient.
11. Am folgenden Tage stand das Heer der Germanen jenseits des Visurgis in Schlachtordnung. Der Caesar glaubte, einem Feldherrn stehe es nicht an, die Legionen ohne Rückhalt von Brücken und ohne deren Sicherung einem entscheidenden Kampf auszusetzen, und schickte daher seine Reiterei durch eine Furt über den Fluss. Stertinius Aemilius, ein Primipilar, befehligten sie. Sie griffen an getrennten Stellen an, um den Feind zur Trennung seiner Truppen zu veranlassen. Wo die Strömung an reißendsten war, ging der Führer der Bataver, Chariovalda, über den Fluss und stürmte vor. Ihn lockten die Cherusker, die zum Schein flohen, in eine Ebene, die rings von Bergwald umgeben war. Dann brachen sie hervor, stürmten von allen Seiten auf den Gegner ein, warfen ihn, wo er Widerstand leistete, zurück, verfolgten die Weichenden und, wenn diese kreisförmig sich zusammenschlossen, trieben sie teils im Nahkampf, teils im Fernkampf vor sich her. Chariovalda, der lange Zeit dem wilden Ansturm standgehalten hatte, ermahnte seine Leute, durch die anstürmenden Scharen mit geballten Kräften durchzubrechen. Er selbst stürzte sich auf den Feind, wo dieser am dichtesten stand, und sank unter einem Hagel von Geschossen von dem durchbohrten Pferd; eine große Anzahl von Edelleuten fiel rings um ihn. Den Rest rettete aus der gefährlichen Lage eigene Kraft oder die Hilfe der Reiterei, die unter Stertinius und Aemilius herbeieilte.
12. Der Caesar ging über den Visurgis und erfuhr durch die Aussage eines Überläufers den von Arminius ausersehenen Kampfplatz. Auch andere Stämme hätten sich in dem Herkules geweihten Wald versammelt und würden es wagen, bei Nacht zum Sturm auf das Lager anzutreten. Man schenkte dieser Aussage Glauben, und wirklich erblickte man Lagerfeuer. Kundschafter die sich näher heranschlichen, meldeten, man höre das Wiehern von Pferden und das dumpfe Geräusch einer riesigen, ungeordneten Marschkolonne. Weil eine entscheidende Schlacht bald zu erwarten war, glaubte nun der Caesar, die Stimmung der Soldaten erforschen zu sollen, und überlegte bei sich, wie er diese unverfälscht feststellen könne. Die Meldungen der Tribunen und Centurionen seien öfters nur darauf berechnet, erfreulich zu wirken, ohne den tatsächlichen Feststellungen zu entsprechen, die Freigelassenen zeigen eine Knechtgesinnung, und den Freunden sei kriecherisches Benehmen eigen. Wenn man eine Soldatenversammlung einberufe, würden auch dort einigen wenigen, die den Ton angeben, alle übrigen lärmenden Beifall zollen. Man müsse ihre Gedanken gründlich kennen lernen, und zwar, wenn sie unter sich und ohne Aufsicht bei dem Soldatenessen offen ihren Hoffnungen oder Befürchtungen Ausdruck geben.
13. Bei Beginn der Nacht verließ er das Feldherrenzelt und ging heimlich, ohne das die Wachen das bemerkten, mit einem einzigen Begleiter, einen Pelz um die Schultern, zu den Lagerstrassen, blieb an den Zelten stehen und erfreute sich des Lobes, das er zu hören bekam: der eine pries den Adel des Heerführers, der andere seine stattliche Erscheinung, die meisten seine Ausdauer und seine Leutseligkeit, sein im Ernst und im Scherz gleich bleibendes Wesen, und sie sprachen offen aus, man müsse in der Schlacht den schuldigen Dank abstatten und zugleich die treulosen und Vertragsbrüchigen der Rache und dem eigenen Ruhm opfern. Inzwischen ritt einer der Feinde, der der lateinischen Sprache mächtig war, an den Wall heran und versprach jedem Überläufer im Namen des Arminius mit lauter Stimme Frauen und Ländereien und für die Dauer des Krieges täglich hundert Sesterzen. Dieses schmachvolle Angebot entflammte den Zorn der Soldaten. Man möge es nur Tag werden und die Waffen sprechen lassen. Nehmen werden die Soldaten sich das Land der Germanen und fortschleppen ihre Frauen. Sie nehmen das gute Vorzeichen an: die Ehefrauen und das Geld der Feinde seien die Beute, die sie sich nehmen werden. Etwa um die dritte Nachtwache stürmte der Feind gegen das Lager heran; doch kam es zu keinem Geschosswechsel. Die Feinde hatten gemerkt, dass vorn auf den Befestigungen zahlreiche Kohorten standen und nichts versäumt war.
14. Die gleiche Nacht brachte dem Germanicus ein beglückendes Traumgesicht. Er sah sich mit dem Opfer beschäftigt und hatte für seine blutbespritzte Praetexta aus den Händen seiner Großmutter Augusta eine andere schöne erhalten. Durch dieses Vorzeichen in gehobene Stimmung versetzt, berief er, da auch die Auspizien günstig ausfielen, die Soldaten zur Versammlung und legte die Maßnahmen dar, die er, wohl überlegt, als geeignet für den bevorstehenden Kampf getroffen habe. Nicht nur auf ebenen Gelände könne der römische Soldat mit Erfolg kämpfen, sondern auch in Wäldern und auf bewachsenen Höhen, wenn man nur den Verstand walten lasse. Denn die riesigen Schilde der Barbaren und ihre gewaltigen Lanzen lassen sich zwischen den Baumstämmen und dem Unterholz keineswegs so gut handhaben wie die Speere und Schwerter der Römer und ihre eng am Körper anliegende Rüstung. Sie sollten unentwegt draufschlagen und mit den Schwertspizen auf das Gesicht zielen. Die Germanen hätten keine Panzer, keine Helme, auch ihre Schilde seien nicht mit Eisen oder Leder verstärkt, sondern nur ein Weidengeflecht oder ein dünnes, mit Farbe bestrichenes Brett. Die erste Reihe sei einigermaßen mit Lanzen ausgerüstet, aber alle übrigen hätten nur vorn im Feuer gehärtete kurze Lanzen. Äußerlich machen sie zwar einen grimmigen Eindruck, auch entwickeln sie einen beachtlichen, aber rasch erlahmenden Angriffschwung, und wenn sie verwundet werden, seien sie zum Widerstand unfähig. Ohne Gefühl für Ehre und Schande, ohne sich um ihre Führer zu kümmern, laufen sie weg, fliehen davon, furchtsam im Unglück, im Glück nicht göttliches, nicht menschliches Recht achtend. Wenn sie der Märsche und Seefahrten müde seien und ein Ende wünschten, so werde es diese Schlacht bringen. Schon seien sie der Elbe näher als dem Rhein, weithin sei kein Krieg mehr zu führen, wenn sie nur ihm, den Spuren seines Vaters und Oheims folge, in eben diesem Lande zum Siege verhelfen.
15. Die Rede des Heerführers erweckte bei den Soldaten begeisterte Kampfstimmung, und das Zeichen zur Schlacht wurde gegeben. Auch Arminius und die übrigen Häuptlinge der Germanen unterließen es nicht, ihren Leuten zu versichern, hier habe man es mit den Römern des Varusheeres zu tun, die so ausgezeichnet zu fliehen verstehen und die, um keinen Krieg auf sich nehmen zu müssen, sich auf Meuterei verlegt hätten. Ein Teil von ihnen habe den Rücken voller Wunden, einem anderen hätten die Sturmfluten die Glieder zerschunden, mit denen sie sich nun wieder ihren erbitterten Feinden und den ungnädigen Göttern ohne irgendwelche Aussicht auf Erfolg entgegenstellen. Sie hätten es mit der Flotte versucht und sich auf die entlegenen Bahnen des Ozeans begeben, damit niemand ihnen wenn sie kommen, entgegentrete und niemand, wenn sie geschlagen würden, ihnen auf den Fersen bleibe. Aber sobald es zum Handgemenge komme, setzen sie vergeblich ihre Hoffnung auf die Hilfe von Winden und Rudern. Sie sollen nur an ihre Habsucht, ihre Grausamkeit und ihren Hochmut denken: bleibe ihnen dann noch etwas anderes übrig, als entweder ihre Freiheit zu behaupten oder zu sterben, ehe man sie zu Sklaven mache.
16. Als sie so begeistert die Schlacht forderten, führte man sie auf ein freies Feld, namens Idistaviso, hinunter. Dies liegt in der Mitte zwischen dem Visurgis und den Hügeln und zieht sich in ungleichen Krümmungen hin, je nach dem die Ufer des Flusses zurücktreten oder Bergvorsprünge sich vorschieben. Im Rücken der Germanen zog sich an einer Anhöhe ein Wald hinauf mit hohen Baumkronen, während zwischen den Stämmen nackter Boden war. Die Ebene und den Waldrand hatte das barbarische Heer besetzt. Nur die Cherusker standen oben auf der Höhe, um sich während des Kampfes von oben auf die Römer zu stürzen. Unser Heer marschierte in folgender Gliederung: an die Spitze die gallischen und germanischen Hilfstruppen, hinter ihnen die Bogenschützen zu Fuß. Dann kamen vier Legionen und mir zwei Prätorianerkohorten sowie auserlesener Reiterei der Caesar, darauf die anderen vier Legionen und die leichtbewaffnete Truppe mit den berittenen Bogenschützen und die restlichen Kohorten der Bundesgenossen. Kampfbereit waren die Soldaten darauf bedacht, dass sich der Aufmarsch aus der Kolonne zur Schlacht in Ordnung vollziehe.
17. Als Germanicus die Scharen der Cherusker, die mit wildem Ungestüm hervorgestürmt waren, erblickte, befahl er dem Kern seiner Reiterei, sie in der Flanke zu fassen, dem Stertinius mit den übrigen Reiterabteilungen eine Umgehungsbewegung zu machen und dem Feind in den Rücken zu fallen. Er selbst werde zu gegebener Zeit zur Stelle sein. Inzwischen lenkte ein herrliches Vorzeichen, acht Adler, die man auf die Wälder zu und dann in sie hineinfliegen sah, die Aufmerksamkeit des Oberfeldherrn auf sich. Er rief “Los! Folget den Vögeln Roms, den Schutzgeistern der Legionen!“ Zugleich ging das Fußvolk zum Angriff über, und die vorausgeschickte Reiterei drang im Rücken und auf den Flanken ein. Und – es klingt seltsam – zwei feindliche Heere flohen in entgegengesetzter Richtung, die Truppe, die den Wald besetzt hatte, rannte in das offene Gelände, diejenige, die in der Ebene Aufstellung genommen hatte, in den Wald. Mitten zwischen ihnen wurden die Cherusker von den Hügeln heruntergeworfen. In ihren Reihen suchte Arminius, deutlich erkennbar, durch persönlichen Einsatz, durch Zurufe und selbst verwundet, die Schlacht zum Stehen zu bringen. Er war auf unsere Bogenschützen eingedrungen und wäre hier durchgebrochen; doch warfen sich ihm die Kohorten der Räter, Vindelicier und Gallier entgegen. Aber dank seiner Körperkraft, mit der er sich Bahn brach, und seinem feurigen Pferde schlug er sich durch. Er hatte, um nicht erkannt zu werden, mit seinem eigenen Blut das Gesicht verschmiert. Manche haben überliefert, er sei von den Chauken, die bei den römischen Hilfstruppen dienten erkannt und durchgelassen worden. Gleiche Tapferkeit – oder List – ermöglichte auch dem Inguiomerus das Entrinnen. Die anderen wurden wo man sie traf, niedergemacht: sehr viele fanden bei dem Versuch, über den Visurgis zu schwimmen, unter dem Geschosshagel oder in der starken Strömung des Flusses, zuletzt dadurch, dass die Menschenmassen übereinander stürzten und das Ufer einbrach, den Tod. Einige kletterten in schmählicher Flucht ganz oben auf die Bäume hinauf, wo sie sich in den Zweigen zu verstecken suchten und von herbeigeholten Bogenschützen zur Kurzweil heruntergeschossen wurden.
18. Groß war dieser Sieg und hatte uns kein Blut gekostet. Von der fünften Stunde des Tages bis zur Nacht dauerte das Morden, und auf einer Strecke von zehn Meilen war der Boden mit erschlagenen Feinden und Waffen bedeckt. Dabei fand man unter der Waffenbeute auch die Ketten, die sie, an ihren Erfolgen nicht zweifelnd , für die Römer mitgebracht hatten. Die Soldaten riefen Tiberius auf dem Schlachtfeld zum Imperator aus und errichteten einen Erdhügel, auf dem sie nach Art von Siegesdenkmälern die erbeuteten Waffen legten und die Namen der hiesigen Völkerschaften anbrachten.
19. Nicht ihre Wunden, nicht ihre Trauer, nicht die Vernichtung ihrer Truppen schmerzte und erbitterte die Germanen so sehr wie dieser Anblick. Sie, die eben noch Anstalten trafen, ihre Wohnsitze zu verlegen und über die Elbe sich zurückzuziehen wollten nun kämpfen, griffen eilends zu den Waffen. Volk und Adel, alte und junge Leute stürzten sich plötzlich auf die römische Marschkolonne und brachte sie in Verwirrung. Zuletzt suchten sie sich einen Kampfplatz aus, der vom Fluss und Wald umschlossen war und in dem sich eine schmale sumpfige Fläche befand. Auch um das Waldgebiet zog sich ein tiefer Sumpf, nur eine Seite hatten die Angrivarier durch einen breiten Damm erhöht, der die Grenzlinie zu den Cheruskern bilden sollte. Hier ging das Fußvolk in Stellung. Die Reiterei nahm in den nahe gelegenen Lichtungen Deckung, um den Legionen, sobald sie in den Wald einmarschiert seien, in den Rücken zu fallen.
20. Dem Caesar blieb von diesen Maßnahmen nichts verborgen. Er kannte die Absichten und die Stellungen der Feinde, ob sie nun offen vor Augen lagen oder verborgen waren, und ihre schlauen Berechnungen suchte er in ihr Verderben zu verwandeln. Dem Legaten Seius Tubero übergab er die Reiterei und wies ihm das ebene Feld zu. Das Fußvolk stellte er so zum Kampf auf, dass ein Teil auf ebenen Gelände an den Wald heranrücken und in ihn einmarschieren und der andere den vor ihnen liegenden Erdwall erklimmen sollte. Diese schwierige Aufgabe behielt er sich persönlich vor, alles übrige überließ er den Legaten. Diejenigen, denen das ebene Gelände zugewiesen war, brachen mühelos in den Wald ein; diejenigen jedoch, die den Erdwall zu erstürmen hatten, hatten, wie wenn sie an eine Mauer vorrückten, unter einer schweren Beschießung von der Mauer herab zu leiden. Der Heerführer erkannte, wie ungleich dieser Nahkampf war. Er zog dagegen die Legionen ein wenig zurück und befahl den Schleuderern und Wurfschützen, ihre Geschosse zu werfen und den Feind vom Wall zu vertreiben. Von den Geschützen wurden Speere abgeschossen, und je sichtbarer die Verteidiger waren, mit um so größeren Verlusten wurden sie heruntergeworfen. An der Spitze seiner Prätorianerkohorten eroberte der Caesar den Wall und trat zum Sturmangriff auf den Wald an, wo man Mann gegen Mann rang. Den Feind riegelte im Rücken der Sumpf, die Römer der Fluss oder die Berge ab. Beide Teile mussten unbedingt ihre Stellung behaupten, sie konnten nur auf ihren Mannesmut sich verlassen und nur von einem Sieg Rettung erhoffen.
21. Nicht geringer Mut beseelte die Germanen. Aber durch ihre Kampfweise und durch die Art ihrer Waffen waren sie unterlegen. Die große Menschenmasse konnte in dem engen Raum ihre überlangen Lanzen weder vorstrecken noch zurückziehen und ihre körperliche Behändigkeit auch nicht zum Anrennen auf den Feind ausnützen, da sie zum Kampf auf einen festen Standort gezwungen war. Dagegen stachen die römischen Soldaten, ihre Schilde fest an die Brust gepresst und mit den Hand fest den Schwergriff umfassend, auf die bereiten Gliedmaßen der Barbaren und ihre ungeschützten Gesichter ein und bahnten sich über die Leichen der Feinde den Weg, während es Arminius infolge der andauernden Kämpfe an Tatkraft fehlen ließ; vielleicht war er auch durch seine frische Verwundung gehemmt. Ja, auch dem Inguiomerus, der auf dem ganzen Schlachtfeld umherflog, verließ weniger der Mannesmut als vielmehr das Glück. Germanicus hatte, um besser erkannt zu werden, seine Kopfbedeckung abgenommen und bat seine Leute, mit dem Morden nicht einzuhalten. Man brauche keine Gefangenen zu machen, nur die Vernichtung des Stammes werde dem Krieg ein Ende setzen. Es war schon spät am Tage, als er eine Legion von dem Kampfplatz abrücken ließ, um ein Lager zu schlagen. Die übrigen sättigten sich bis zum Eintritt der Nacht an dem Blut der Feinde. Der Kampf der Reiterei brachte keine Entscheidung.
22. Der Caesar lobte vor versammelter Mannschaft die Sieger und ließ eine Waffenpyramide errichten mit der stolzen Aufschrift: „Nach Niederkämpfung der Völkerschaften zwischen Rhein und Elbe hat das Heer des Tiberius Caesar dieses Erinnerungsmal dem Mars und Juppiter und Augustus geweiht.“ Über sich fügte er nichts hinzu. Entweder fürchtete er sich vor dem Neid, oder er glaubte, er könne zufrieden sein mit dem Bewusstsein seiner Leistung. Dann übertrug er die Kriegsführung gegen die Angrivarier dem Stertinius für den Fall, dass sie sich nicht beschleunigt unterwerfen würden. Da sie demütig baten und sich mit allen Bedingungen einverstanden erklärten, wurde ihnen auch alles verziehen.
23. Aber da es bereits Hochsommer war, wurde ein Teil der Legionen auf dem Landmarsch in die Winterquartiere zurückgeschickt. Den größeren Teil schiffte der Caesar ein und fuhr mit ihm auf der Amisa in den Ozean. Anfangs war die See noch ruhig; sie rauschte unter dem Ruderschlag von tausend Schiffen oder wogte auf, wenn die Segel aufgezogen wurden. Bald aber ging ein Hagelschauer aus einer schwarzen Wolkenwand nieder, und zugleich brausten von allen Seiten heftige Böen heran, unberechenbare Flutwellen nahmen die Sicht und hinderten die Steuerung der Schiffe. Von den verzagten Mannschaften, die mit der Seefahrt nicht vertraut waren, wurden die Seeleute, denen sie unsachgemäß helfen wollten, gestört. Und sie machten so den sachkundigen Matrosen ihre Verrichtungen unmöglich. Dann wurde über dem ganzen Himmel und das ganze Meer der Südwind Herr. Er führte von den feuchtdunstigen Ländern Germaniens und den tiefen Flüssen gewaltige Wolkenmassen mit Macht heran, und die Kälte des nahen Nordens machte ihn noch schrecklicher. Und so riss er die Schiffe fort und verschlug sie auf den offenen Ozean oder ließ sie an Inseln, die mit ihren schroffen Klippen oder verborgenen Untiefen gefährlich waren, stranden. War man diesen mit knapper Not und Mühe ausgewichen, so konnte man nachher, als die Flut wechselte und sich in der Windrichtung bewegte, die Schiffe nicht mehr fest verankern und auch nicht die hereinbrechenden Wassermassen ausschöpfen. Pferde, Zugtiere, Gepäck, sogar Waffen wurden über Bord geworfen, um den Schiffsraum zu entlasten, in den das Wasser durch die Bordwände eindrang und die Fluten von oben her hereinstürzten.
24. Je stürmischer der Ozean als jedes andere Meer und das Wetter Germaniens grimmiger ist als anderwärts, um so mehr hob sich jenes, noch nie erlebte Unglück durch sein Ausmaß heraus; ringsum waren die Gestade in den Händen der Feinde oder das Meer so unermesslich und unergründlich, dass man glaubte, man sei am Ende der Welt und hinter ihm komme kein Land mehr. Ein Teil der Schiffe ging unter, die Mehrzahl strandete an weiter entfernt gelegene Inseln, wo die Leute, da dort keine Menschen wohnten, verhungerten, mit Ausnahme derer, die sich mit dem Fleisch der ebenfalls an Land geschwemmten Pferde am Leben erhielten. Nur der Dreiruderer des Germanicus landete im Gebiet der Chauken. In allen diesen Tagen und Nächten stand er bei den Klippen und Küstenvorsprüngen und rief, er sei an diesem vernichtenden Unglück schuld, wobei er von seinen Freunden nur mit Mühe davon zurückgehalten werden konnte, in dem gleichen Meere den Tod zu suchen. Als endlich die Flut zurück ging und ein günstiger Wind aufkam, fanden sich die Schiffe, beschädigt und mit spärlichem Ruderwerk, oder mit ausgespannten Tüchern, einige auch im Schlepptau von stärkeren, wieder ein. Diese ließ er beschleunigt wieder instand setzen und schickte sie aus, um die Inseln abzusuchen. Dank dieser fürsorglichen Maßnahme wurden sehr viele Leute wieder zusammengeholt. Viele wurden auch durch die Angrivarier, die sich kürzlich unterworfen hatten, von den tiefer im Binnenland wohnenden Stämmen losgekauft und zurückgegeben. Einige, die nach Britannien verschleppt waren, wurden von den dortigen Fürsten zurückgeschickt, wer aus weiter Ferne zurückgekehrt war, erzählte Wundergeschichten von gewaltigen Wirbelwinden und von Vögeln, von denen man noch nie vernommen habe, von Meerungeheuern und von Zwittergeschöpfen aus Mensch und Tier, mögen sie diese nun wirklich gesehen oder in der Angst es sich nur eingebildet zu haben
25. Aber die Kunde von dem Verlust der Flotte ermutigte einerseits die Germanen dazu, ihre Hoffnung auf den Krieg zu setzen, andererseits den Caesar, Gegenmaßnahmen zu treffen. Dem C. Silius befahl er mit dreißigtausend Mann zu Fuß und dreitausend Reitern in das Land der Chatten zu ziehen. Er selbst brach mit noch größerer Truppenmacht in das Gebiet der Marser ein, deren Führer Mallovendus erst kürzlich sich unterworfen hatte und nun aussagte, in einem nahen Hain sei der Adler einer Varianischen Legion vergraben und werde schwach bewacht. Sofort wurde eine Abteilung abgeschickt, den Feind von vorne zu einen Kampf herauszulocken, während andere ihn im Rücken umgehen und den Adler ausgraben sollten. Beiden Abteilungen stand das Glück zur Seite. Um so entschlossener setzte der Caesar den Marsch in das Innere des Landes fort, plünderte und brandschatzte, ohne das sich der Feind zu stellen wagte; wo er Widerstand leistete, wurde er sofort geschlagen und, wie man von den Gefangenen erfuhr, wie nie zuvor in Schrecken versetzt. Denn sie erklärten, unbesiegbar und durch keine Schicksalsschläge bezwingbar seien die Römer, die nach der Vernichtung ihrer Flotte, nach dem Verlust ihrer Waffen, nachdem die Gestade mit den Leichen von Pferden und Mannschaften bedeckt gewesen seien, mit dem gleichen Angriffsgeist und scheinbar mit vermehrter Truppenmacht in das Land eingebrochen seien.
26. Dann wurden die Truppen in die Winterquartiere zurückgeführt. Sie waren in froher Stimmung, da das Missgeschick zur See durch die erfolgreiche Unternehmung zu Lande aufgewogen war. Und diese Stimmung erhöhte noch Germanicus durch Freigebigkeit; er ersetzte jedem seinen Schaden in der Höhe, die er angegeben hatte. Auch hielt man es für unzweifelhaft, dass der Widerstand der Feinde ins Wanken komme und sie sich mit der Absicht tragen, um Frieden zu bitten. Der Krieg könne beendigt werden, wenn man noch den nächsten Sommer hinzunähme. Aber Tiberius ermahnte Germanicus in mehreren Briefen, er solle zu Feier des bewilligten Triumphes zurückkehren. Es sei genug der Erfolge, genug der Misserfolge. Germanicus könne auf erfolgreiche und große Kämpfe zurückblicken. Er möge auch an all die schweren Verluste denken, die Stürme und Fluten verursacht hätten, für den zwar der Führer keine Schuld treffe, die aber doch schwer und schrecklich seien. Er selbst sei neunmal von dem Vergöttlichten Augustus nach Germanien geschickt worden und habe dort mehr durch kluges als durch gewaltsames Vorgehen erreicht. So hätten sich die Sugambrer unterworfen, so habe man die Sueben und den König Maroboduus durch einen Frieden verpflichtet. Auch könne man die Cherusker und die übrigen aufrühreririschen Völkerschaften, da man der Rache Roms genuggetan habe, ihren inneren Zwistigkeiten überlassen. Als Germanicus um ein weiteres Jahr bat um seine Unternehmungen zu Ende zu führen, appellierte er noch nachdrücklicher an seine Loyalität, in dem er ihm ein zweites Konsulat anbot, das er persönlich in Rom annehmen solle. Daran knüpfte er die Bemerkung, wenn man weiterhin Krieg führen müsse, so solle er die Gelegenheit, Ruhm zu erweben, seinem Bruder Drusus zubilligen, der, da es jetzt außer in Germanien keinen Feind mehr gebe, nur dort den Imperatorentitel erlangen und den Lorbeer sich holen könne. Germanicus zögerte nun nicht weiter, obgleich er merkte, dass dies alles nur vorgetäuscht sei und ihm aus Neid der bereits errungene Ruhm entrissen werde.
41. Am Jahresende wurden bei dem Tempel des Saturnus wegen der Wiedergewinnung der mit Varus verlorenen Feldzeichen, die unter der Führung des Germanicus und unter der Regierung des Tiberius erfolgt war, ein Triumphbogen, ferner ein Tempel der Fors Fortuna neben dem Tiber in dem Park, den der Diktator Caesar dem römischen Volk vermacht hatte, und eine Kapelle der julischen Gens sowie ein Standbild dem vergöttlichten Augustus in Bovillae geweiht.
(17 nach Chr.:)
43. Unter dem Konsulat des C. Caelius und L. Pomponius triumphierte Germanicus Caesar am 26.Mai über die Cherusker, Chatten und Angrivarier und die anderen Völkerschaften, die bis zur Elbe wohnen. Mitgeführt wurden erbeutete Waffen, Gefangene, Bilder von Bergen, Flüssen und Schlachten. Und weil man Germanicus daran gehindert hatte, den Krieg zu beendigen, nahm man ihn als beendigt an. Das Bild, das sich den Zuschauern bot, bekam noch durch des Germanicus hervorragende äußere Erscheinung einen besonderen Glanz sowie durch den Wagen, auf dem seine fünf Kinder fuhren.
44. Nicht lange darauf wurde Drusus nach Illyricum geschickt, damit er sich an den Kriegsdienst gewöhne und sich die Zuneigung des Heeres erwerbe. Zugleich glaubte Tiberius, dass der Jüngling, der sich dem üppigen Leben der Hauptstadt hingab, im Lager besser aufgehoben sei und es für ihn selbst größere Sicherheit bedeutete, wenn beide Söhne Legionen befehligten. Aber als Vorwand dienten die Sueben, die um Hilfe gegen die Cherusker baten. Denn nach dem Abzug der Römer hatten sie, der Furcht vor dem auswärtigen Feind ledig, nach Stammesgewohnheit und jetzt in ruhmbegieriger Eifersucht die Waffen gegeneinander gekehrt. Die Stärke der beiden Stämme und die Tüchtigkeit ihrer Führer waren gleich. Aber Maroboduus machte bei seinen Leuten der Königsname verhasst, Arminius sein Kampf für die Freiheit beliebt.45. Und so griffen nicht nur die Cherusker und deren Verbündete, die alte Mannschaft des Arminius, zu den Waffen, sondern auch aus dem Königsreich des Maroboduus fielen suebische Stämme, Semmnonen und Langobarden, zu ihm ab. Mit diesem Zuwachs hätte er die Übermacht gehabt, wenn nicht Inguiomerus mit einer Schar seiner Klienten zu Maroboduus geflohen wäre, lediglich deshalb, weil es dem alten Oheim unwürdig erschien, dem jungen Sohn seines Bruders sich unterzuordnen. Die Heere stellten sich mit gleichen Siegeshoffnungen zur Schlacht auf. Aber sie stürmten nicht mehr, wie es früher bei den Germanen üblich war, regellos oder in getrennten Heerhaufen auf den Feind los. Denn sie hatten sich in langem Kriegsdienst gegen und daran gewöhnt, den Fahnen zu folgen, und sich durch Reserven zu sichern und auf die Befehle der Heerführer zu achten. Jetzt besichtigte Arminius zu Pferd alles und wies überall, wohin er ritt, auf die wieder gewonnene Freiheit, die erschlagenen Legionen und auf die den Römern abgenommenen Waffen hin, die immer noch in vieler Hände seien. Dagegen nannte er Maroboduus einen Ausreißer, der noch keine Schlacht mitgemacht habe, in den Verstecken des herkynischen Waldes Schutz gesucht und dann durch Geschenke und Gesandtschaften um ein Bündnis gebeten habe, einen Verräter des Vaterlandes, einen Trabanten des Caesaren, den man mit der gleichen Erbitterung verjagen müsse, wie sie Quintilius Varus erschlagen hätten. Sie sollten sich nur an die vielen Kämpfe erinnern, die schließlich mit der Vertreibung der Römer geendet hätten, wodurch ausreichend erwiesen sei, in wessen Händen die endgültige Entscheidung des Krieges gelegen habe.
46. Auch Maroboduus sparte nicht mit prahlendem Eigenlob oder Beschimpfungen der Feinde. Dagegen beteuerte er, Inguiomerus an der Hand haltend, dessen Person sei der Inbegriff der ganzen Ehre der Cherusker, dessen Ratschlägen seien alle bisherigen Erfolge zu verdanken. Arminius nehme in seinen Wahn und in der Verkennung der wahren Lage fremden Ruhm für sich in Anspruch, weil er drei Legionen, die planlos daherzogen, und einen arglosen Führer treulos getäuscht habe, zum großen Unglück für Germanien und zu seiner eigenen Schande, da seine Gattin, da sein Sohn noch immer in Knechtschaft schmachten. Er aber habe, von zwölf Legionen unter der Führung des Tiberius angegriffen, den Ruhm der Germanen unbefleckt bewahrt, und dann habe man sich nach Abschluss eines Vergleichs getrennt. Und er bereue es nicht, dass es in einer Hand liege, ob sie lieber von neuem Krieg mit den Römern oder einen Frieden ohne Blutvergießen haben wollten. Außer diesen Worten, die bei den Heeren begeistert aufgenommen wurden, spornten sie noch besondere Gründe an: die Cherusker und Langobarden stritten für ihre alte Ehre oder für ihre neu gewonnene Freiheit, die Gegner für die Erweiterung ihrer Herrschaft. Nirgends sonst war man mit größerer Wucht aufeinander geprallt, und nie war der Ausgang zweifelhafter gewesen: auf beiden Seiten wurde der rechte Flügel geschlagen. Man erwartete, dass die Schlacht wieder aufgenommen würde. Doch Maroboduus zog seine Truppen in den Schutz eines Hügelgeländes zurück. Dies war das Zeichen dafür, dass er sich geschlagen fühlte. Und da er allmählich durch das Überlaufen seiner Leute geschwächt wurde, zog er sich in das Gebiet der Markomannen zurück und schickte Gesandte an Tiberius mit der Bitte um Hilfe. Die Antwort lautete, er habe kein Recht, gegen die Cherusker römische Waffenhilfe anzurufen, da er ja den Römern bei ihrem Kampf gegen den gleichen Feind keinerlei Hilfe gewährt habe. Jedoch wurde Drusus, wie schon berichtet, abgeschickt, um den Frieden zu sichern.
(19 nach Chr.:)
88. Ich finde bei den Schriftstellern senatorischen Ranges dieser Zeit, dass in dem Senat ein Brief des Chattenfürsten Adgandestrius verlesen wurde, in dem er den Tod des Arminius versprach, wenn ihm zur Durchführung des Mordes Gift geschickt werde. Doch sei ihm der Bescheid erteilt worden, nicht hinterlistig und nicht heimlich, sondern offen mit der Waffe in der Hand räche sich das römische Volk an seinen Feinden. Mit diesem rühmlichen Verhalten stellte sich Tiberius den Feldherrn alter Zeiten zur Seite, die die Verwendung von Gift gegen Phyrrus abgelehnt und ihn von den beabsichtigten in Kenntnis gesetzt hatten. Indessen stieß Arminius bei dem Abzug der Römer und nach der Vertreibung von Maroboduus in seinem Streben nach dem Thron auf den Widerstand seiner freiheitsliebenden Landsleute. Es kam zu einer bewaffneten Auseinandersetzung, bei der er mit wechselndem Glück kämpfte und durch die Hinterlist seiner Verwandten fiel. Unstreitig war er der Befreier Germaniens, der das römische Volk nicht am Anfang seiner Geschichte, wie andere Könige und Heerführer, sondern das in höchster Blüte stehender Reich herausgefordert hat, in den einzelnen Schlachten nicht immer erfolgreich, im Kriege unbesiegt. Er wurde 37 Jahre alt, zwölf Jahre hatte er die Macht in Händen, und noch immer besingt man ihn bei den barbarischen Völkern. Die griechische Geschichtsschreibung die nur die eigenen Taten bewundert, kennt ihn nicht, und bei den Römern spielt er nicht die ihm gebührende Rolle, da wir die alte Geschichte rühmend hervorheben und der neuen gleichgültig gegenüberstehen.
Annalen XII
(50 nach Chr.:)
27. In der gleichen Zeit versetzte Obergermanien das Anrücken der Chatten, die sich auf Raubzügen befanden, in Schrecken. Deshalb schickte der Legat P.Pomponius die Hilfsvölker der Vangionen und Nemeter, die durch bundesgenössische Reiterei verstärkt waren, ab mit der Weisung, die Plünderer zu überholen oder, wenn sie sich zerstreut hätten, unversehens zu umzingeln. Den klugen Plan des Führers unterstützte die Tatkraft der Soldaten. Sie wurden in zwei Kolonnen eingeteilt. Diejenige, die den linken Weg eingeschlagen hatte, umzingelte die eben zurückgekehrten Feinde, die in dem Genuss ihrer Beute schwelgten und in tiefen Schlafe lagen, wobei die Freude noch dadurch vermehrt wurde, dass sie einige Leute vierzig Jahre nach der Niederlage des Varus aus der Knechtschaft befreiten.
39. Besonders hartnäckigen Widerstand leisteten die Silurer, die ein ihnen bekannt gewordenes Wort des römischen Oberbefehlshabers aufstachelte: „Wie einst die Sugambrer ausgerottet oder nach Gallien umgesiedelt wurden, so ist der Name der Silurer mit Stumpf und Stiel auszutilgen.“
Annalen XIII
(59 nach Chr.:)
55. Diese Ländereien (der Friesen) nahmen nun die Ampsivarier in Besitz, ein Volksstamm, der stärker nicht nur aufgrund seiner eigenen Mittel, sondern dem auch das Mitgefühl der angrenzenden Völkerschaften zugute kam, weil er, von den Chauken vertrieben, heimatlos um eine gesicherte Zukunft bat. Es war bei ihnen ein bei jenen Stämmen berühmter und auch uns treu ergebener Mann namens Boiocalus, der erzählte, er sei bei dem Aufstand der Cherusker auf Befehl des Arminius in Fesseln gelegt worden, habe dann im Heere des Tiberius und Germanicus gedient und wolle einen fünfzigjährigen Gehorsam damit krönen, dass er sein Volk unter unsere Botmäßigkeit bringe. Wie viel Land liege brach, auf das höchstens dann und wann das Groß- und Kleinvieh der Soldaten getrieben werde! Mögen sie, während Menschen hungern, nur ihre Herden auf ihnen vorbehaltenen Weideplätzen hüten, nur solle eine wüste Einöde nicht lieber sein als befreundete Völkerschaften. Den Chamavern hätten einst diese Fluren, dann den Tubanten und hernach den Usipetern gehört. Wie der Himmel den Göttern, so sei die Erde den Sterblichen gegeben. Was niemand gehöre, gehöre jedem. Dann zur Sonne und die anderen Gestirne anrufend, fragte er sie, als ob sie leibhaftig da wären, ob sie auf ein ödes Land schauen wollten. Möchten sie doch lieber gegen die Räuber der Erde das Meer fluten lassen!
56. Durch diese Vorstellungen gerührt, erklärte Avitus, man müsse sich den Geboten der Besseren fügen. Dies sei der Wille der Götter, die sie anflehen, dass in den Händen der Römer selbst die Entscheidung darüber bleibe, was sie nehmen und was sie geben wollten, und das sie keine anderen Richter als sich selbst dulden. Das war seine Antwort an die Ampsivarier in ihrer Gesamtheit. Dem Boiocalus erklärte er aber persönlich, er werde ihm in Gedenken an seine Freundschaft Land anweisen. Dies lehnte Boiocalus als einen Verräterlohn ab und fügte hinzu: „Fehlen kann es uns an Land zum Leben, zum Sterben kann es uns nicht fehlen.“ Und so trennten sie sich in feindlicher Stimmung.